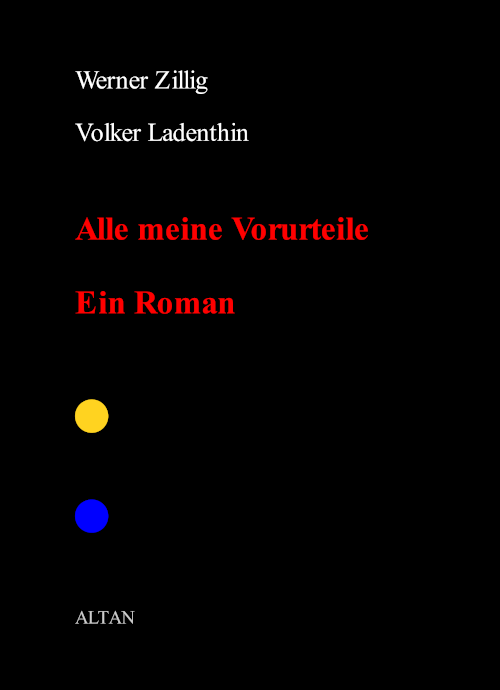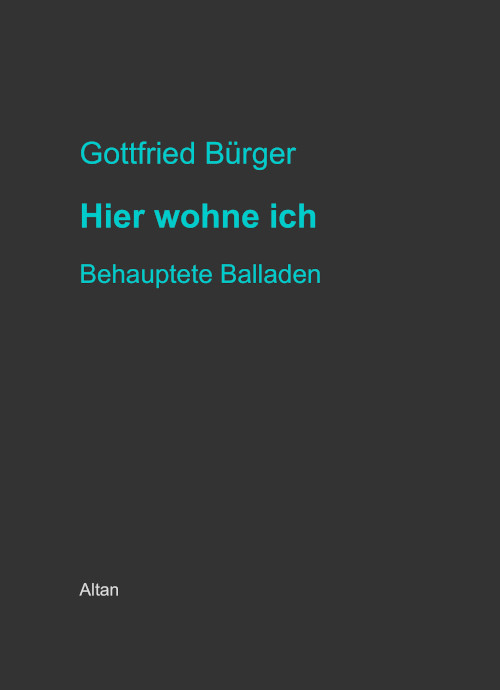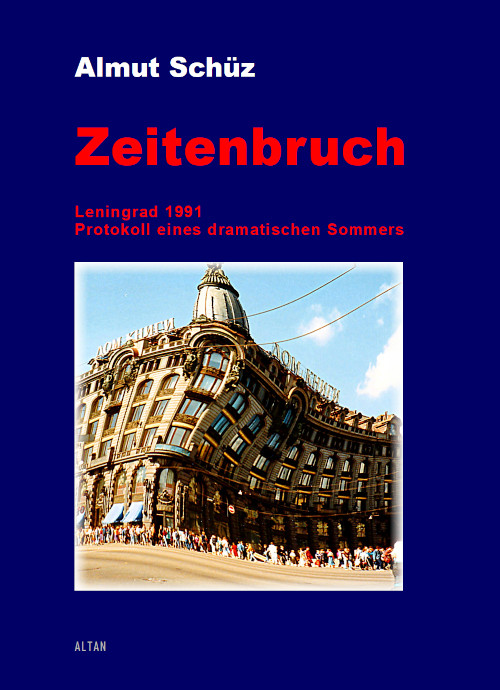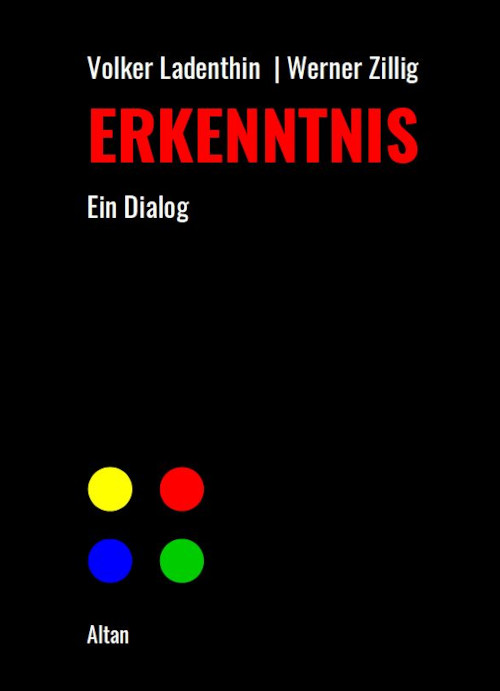Altan Verlag
Bücher
Kapitel
Seiten
Die Balladen aus dem Nachlass des Göttinger Philosophen und Schriftstellers Gottfried Bürger wurden in den Jahren 1972 bis 1993 geschrieben. Bürger hat diese Gedichte in freien Rhythmen selbst nicht veröffentlicht.
Soll man Texte, die ein Autor ganz offensichtlich nicht veröffentlicht sehen wollte, am Ende doch öffentlich machen? Ist das erlaubt? Was ist dann von solchen Texten zu halten? Der Göttinger Philosoph und Schriftsteller Gottfried Bürger hat diese Balladen – wir wissen das aus seinen Tagebüchern – nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Kollegen und Freunde des im Jahre 1994 ermordeten Autors haben lange diskutiert, ob man gegen Bürgers Willen diese Texte herausbringen soll. Es sprach vieles dagegen, und vieles, am Ende mehr, sprach dafür, diese über einen langen Zeitraum und in unregelmäßigen Abständen geschriebenen Gedichte zugänglich zu machen.
Diese Veröffentlichung folgt einem Satz, den eine der Gestalten in Bürgers Erzählung ›Gwendolins Rache‹ sagt: »Nur wenn wir sie als Spiel betrachten, bekommt die Geschichte einen Sinn.«
Die sieben Illustrationen in diesem Band stammen von der japanischen Künstlerin Jikan.
Als Schriftsteller war er »der Schöpfer des neuen deutschen Schreckensromans« (Manfred Rosen). 1994 ist Bürger unter niemals geklärten Umständen in Göttingen ermordet worden.
Auszug
Erinnerungen
Ein Steilhang eines schroffen Gebirges und
weithin sichtbar aufgestellt
eine Fahne im Wind.
Ein gelber Fetzen,
der weithin kündet:
»Hier wohne ich, zum Ende
ausgebleicht.
Hier oben,
allein.«
Wer wollte die Beschwernisse des weiten Ganges,
des Steigens und Niedergehens und Steigens,
auf sich nehmen
nur für ein Windzeichen?
Weiß einer, ob sie noch lebt in ihrer armseligen Höhle,
diese Frau, die jetzt schon
so alt ist und
nur noch durch den Blick ihrer Augen
an die vergangene Schönheit erinnert?
Gesetzt, dass sie noch lebt.
So sahen wir also die Fahne
und blieben
in unseren sicheren Tälern.
Wir sahen hinauf.
»Hier wohne ich,
der Liebe
ausgebleichter Rest.«
De Mortuis
Während Rudolfo des Nachmittags in der Schlacht stand
und für die Ehre seines Vaterlandes focht,
stand Emanuel, sein Bruder, in der väterlichen Scheune
und beschloss die Resignation.
Rudolfo wurde getroffen
um Viertel vor vier
knapp oberhalb des linken Auges.
Emanuel brauchte länger, denn
er hatte Vorbereitungen zu treffen:
Ein Stuhl, ein Balken, ein Seil.
Rudolfo war mithin schon tot, als Emanuel
den Strick am Balken befestigt hatte und
sorgfältig die Knotenschlinge knüpfte.
Er sprang, als die Schlacht schon entschieden war.
Rudolfo siegte mit den Seinen.
Es lag nicht in Emanuels Verantwortung,
dass der Strick riss.
Sein Entschluss war fest und ehrlich gewesen.
Rudolfo verlieh man das Ehrenzeichen,
brachte ihn zum heimatlichen Friedhof, um ihn
mit militärischen Ehren
zu bestatten, den Orden auf dem Sarg.
Emanuel nahm,
ehe sie den Sarg des Bruders in die Erde senkten,
den Orden heimlich an sich.
Sonntag für Sonntag
steckt er ihn nun an und geht
über die Wiesen hinter dem väterlichen Gehöft.
Jeden, der ihm begegnet, fragt er:
»Habe ich diesen Orden nicht verdient?«
Alle ohne Ausnahme stimmen ihm zu
und gehen schnellen Schritts vorüber.
Die Schrift
»Verzeiht mir, Freunde,
dass ich euch belästige.
Ich weiß, es ist spät,
und die Läden eurer Fenster
sind schon geschlossen …«
So trat er, triefend vor Nässe,
vor seine Jünger.
Er schlug sich den Hut
mit einer verlegenen Geste auf
den rechten Oberschenkel
und sah zu Boden.
»Das Wetter ist schrecklich«, sagte er,
und die Jünger fanden,
ein solcher Satz sei eines Gottes unwürdig.
»Lieber hättest du, unser Gott,
dem Sturm ein Ende gebieten sollen,
statt dich in dieser Weise vor uns zu beklagen«,
sagte der Oberste Priester,
sein irdischer Stellvertreter,
und lachte verlegen.
»Sollen wir der Gemeinde verkünden,
du seist zu Fuß durch den Regen gekommen,
und der Schlamm an deinen Schuhen sei heilig?«
»Ich sehe, ihr wollt euch
darüber beraten, was zu tun sei«, sagte er.
»Ich werde solange vor die Tür gehen.
Holt mich herein, wenn ihr
zu einem Ende gekommen seid.«
Er wandte sich um und schloss leise die Tür.
»Was also sollen wir tun?«, fragte der Oberste Priester.
»Er ist unser Gott und wir müssen ihn aufnehmen«,
sagte ein anderer mit bedächtiger Miene.
»Und es kann sein, dass er
seine einstige Macht noch nicht ganz verloren hat«,
argwöhnte ein Dritter.
Sie kamen überein, dem Gott
vorübergehend Aufenthalt zu gewähren,
wenn er sie über die Auslegung
der schwierigen Stellen in den Heiligen Schriften belehre.
Jener Stellen, die sich ihrem steten Bemühen
bis zu diesem Tag widersetzt hatten.
So blieb der Gott und erklärte den Priestern
den Sinn der dunkelsten Sätze.
Als er damit geendet hatte,
sagten die Priester: »War uns die Bedeutung dieser Worte
jemals unklar? Nein, wir waren nur barmherzig,
und wir haben ihm Gelegenheit gegeben,
seinen Aufenthalt bei uns zu rechtfertigen.
Nun aber soll er wieder gehen, denn er ist ein Gott,
und in seiner Gegenwart fällt uns das Atmen schwer.«
An diesem Tag ging der Gott wieder fort,
und die Priester sahen ihm nach, als er
die glühende Straße entlang schritt.
Die Sonne brannte vom Himmel,
und jeder Schritt des Gottes wirbelte
den Staub der Straße empor.
Der Schöpfer
»Soll man der Form«,
fragte er den Schöpfer,
»Anteil an dem geben,
was erschaffen werden soll?«
Der Schöpfer antwortete:
»Die Form wird sein:
das ganz und gar Gewöhnliche.«
»Wie aber«, so fragte er verwirrt,
»kann das ganz Gewöhnliche
das neu Geschaffene bergen,
in dieser Stadt, die doch
auf ewig war und ist und sein wird?«
»Die Antwort auf diese Frage«,
sagte der Schöpfer,
ȟberlassen wir denen, die
die Stadt am Ende der Zeiten
bewohnen werden.«
Und versonnen setzte der Schöpfer hinzu:
»Denn du bist mein Sohn …«
Leseprobe herunterladen
Alle Bücher