Altan Verlag
Über den
Verlag
Ein Altan ist eine erhöhte Plattform, die einen Blick über das Geschehen ringsum ermöglicht. Im Gegensatz zum Balkon ist diese Aussichtswarte mit der Erde verbunden. Das Bild ist daher gleichzeitig ein Mission Statement: Bücher mit gehobenem, aber nicht abgehobenem, Niveau für eine breite Leserschaft.
Wir eröffnen unsere Sachbuchreihe mit:
„Zielverführung. Wer für alles eine Lösung weiß, hat die Probleme nicht verstanden.“ Herausgegeben von Hartwig Eckert und Jose Julio Gonzalez
Die Belletristik-Reihe wird eröffnet mit:
„Hier wohne ich. Behauptete Balladen“ von Gottfried Bürger
Ein Altan ist eine erhöhte Plattform, die einen Blick über das Geschehen ringsum ermöglicht. Im Gegensatz zum Balkon ist diese Aussichtswarte mit der Erde verbunden. Das Bild ist daher gleichzeitig ein Mission Statement: Bücher mit gehobenem, aber nicht abgehobenem, Niveau für eine breite Leserschaft.
Bücher




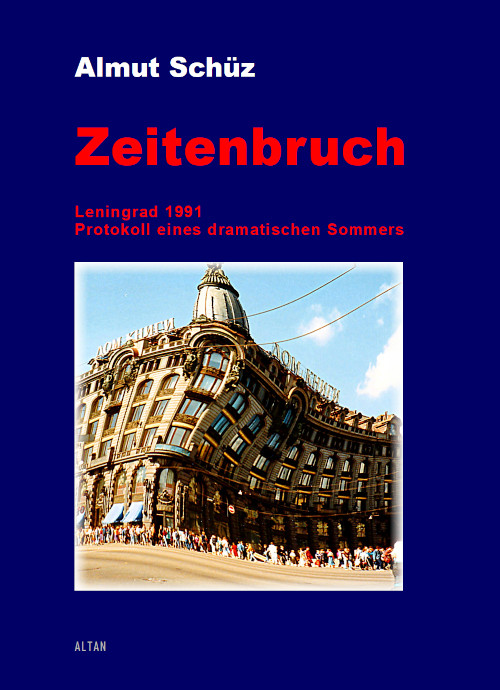

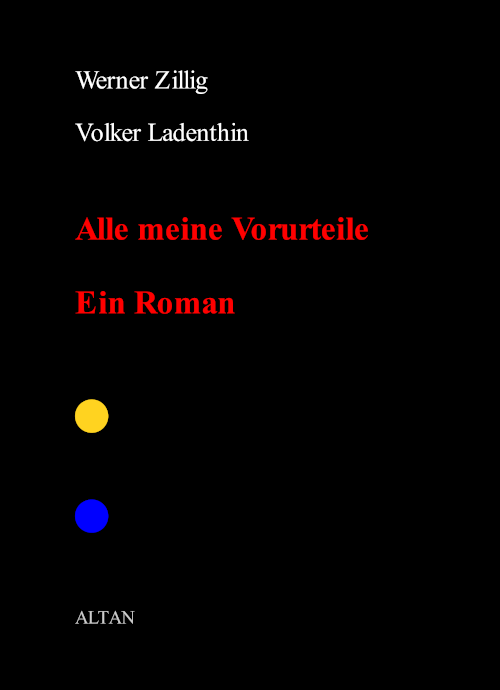
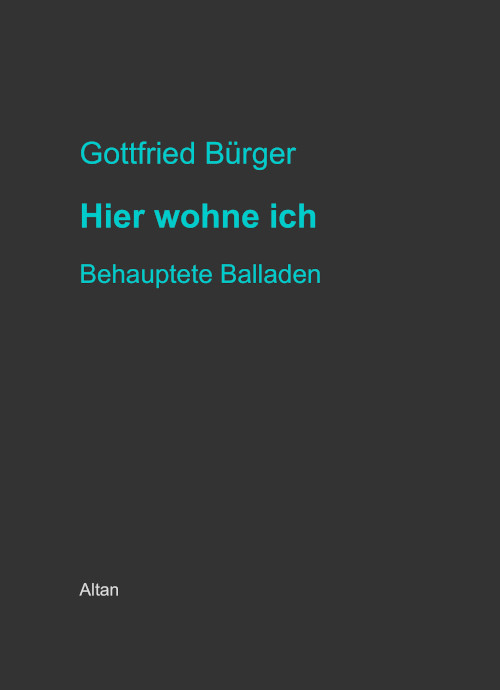



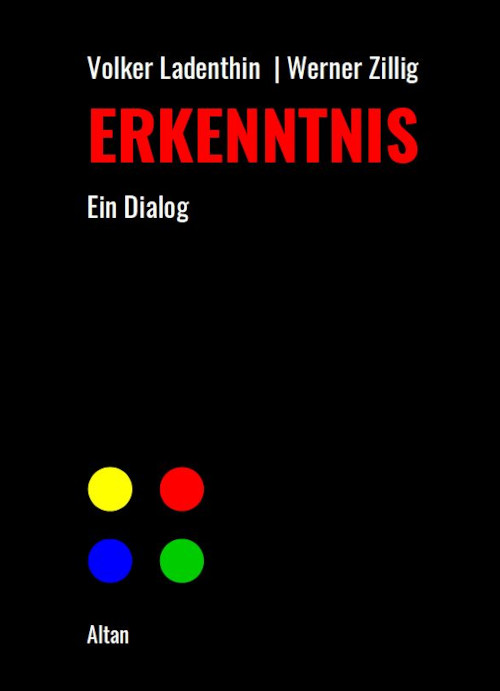


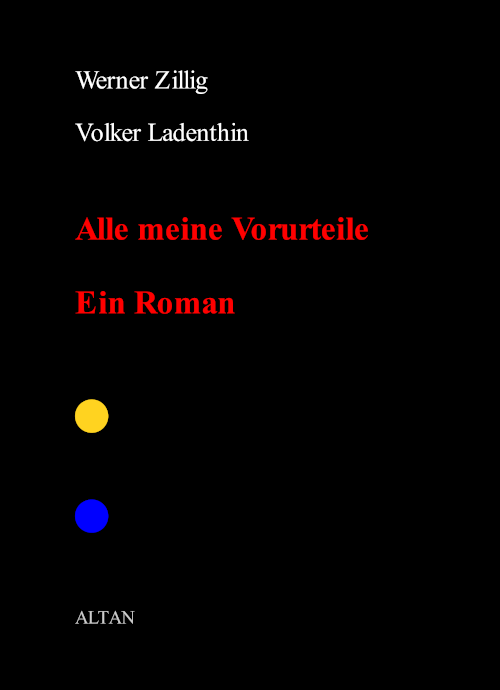
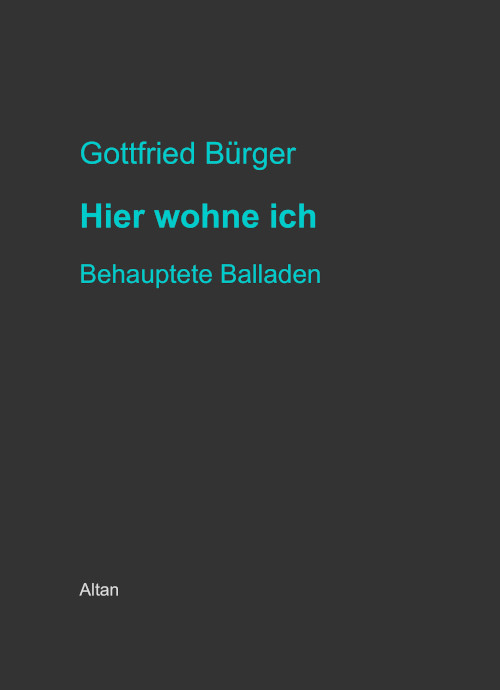




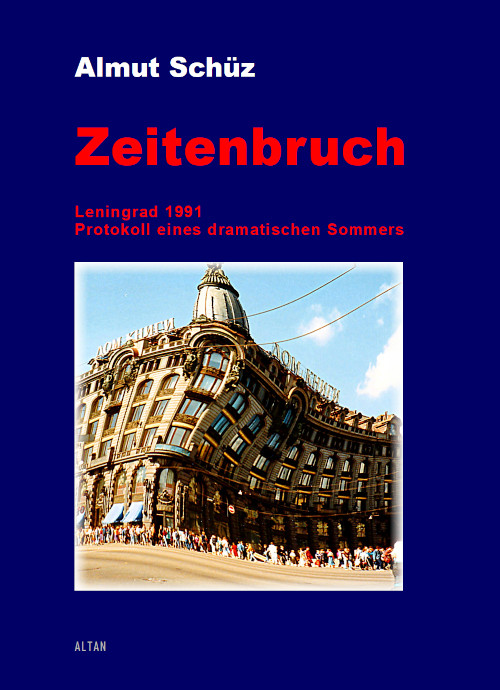


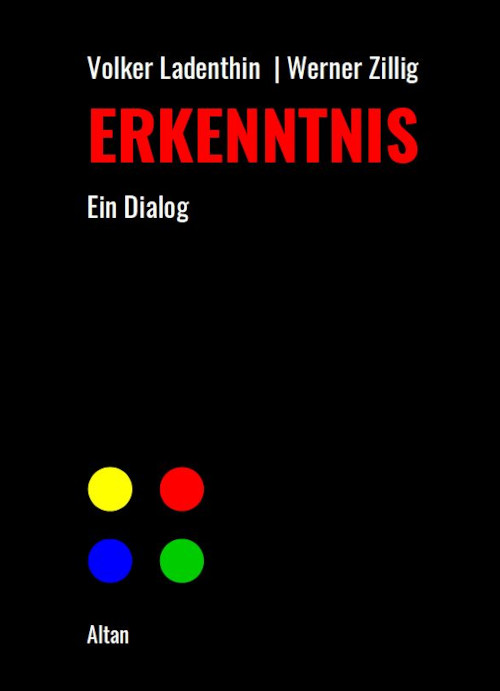
Auszüge
Erkenntnis – Ein Dialog
Inhalt
Ja, wir können Erkenntnisse haben, ansammeln! Wir sind auf einem guten Weg!
Und:
In der Wissenschaft, der Technik und im Alltag gibt es ›Kenntnisse‹; aber in den großen letzten Fragen, dort, wo wir von den großen letzten ›Erkenntnissen‹ sprechen, sind wir nicht weitergekommen. Immerhin: Die Gründe für dieses Scheitern lassen sich benennen.
Auszug
Vorwort
Wir sollten es wohl einfach zugeben: Wir hatten uns, nachdem wir diesen langen E-Mail-Dialog ›Alle meine Vorurteile. Ein Roman beendet und in Buchform gebracht hatten – wir hatten uns an diese Form des Schreibens gewöhnt. Ein schneller Gedankenaustausch per E- Mail. Das Prinzip, das Heinrich von Kleist in seiner kleinen Schrift ›Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden‹ vorgestellt hat, wird abgewandelt: Die Gedanken werden beim E-Mail-Lesen und -Schreiben entwickelt.
Das neue Thema für einen Dialog war schnell einvernehmlich gefunden. In dem Buch, das wir inzwischen abkürzend Vorurteile / Roman nennen, sind im Register nur drei Stellen aufgeführt, an denen wir uns mit dem Stichwort ›Erkenntnis‹ beschäftigt haben. Hinzu kommen zweimal einige Überlegungen zu der Frage, ob die erzählende Literatur und insbesondere der Roman wohl eine eigene Form der Erkenntnis hervorbringen, und schließlich, zur Seite 196, noch der etwas geheimnisvoll anmutende Eintrag ›Erkenntnis, unendliche ~‹. Der Eintrag verweist auf einen Satz von Max Bense, der da zitiert wird und lautet: »Man könnte also den Versuch wagen, die daseinsrelative Stufe, auf der die Gegenstände der klassischen Physik sich befinden, der endlichen Erkenntnis zuzuordnen.« Was also, das sollte das Thema sein, sagen wir zum Thema ›Erkenntnis‹ und, das Stichwort ist nahebei, zum Thema ›Erkenntnistheorie‹?
Wir haben uns wieder begeistert und dabei immer wieder die Feststellung gemacht, dass wir, obwohl ziemlich gleich universitär sozialisiert, doch sehr unterschiedliche Grundannahmen haben. Der eine, Volker Ladenthin, auf den deutschen Idealismus ausgerichtet und mit einem eigenen erziehungswissenschaftlichen Ansatz. Der andere, Werner Zillig, als Linguist durch die Schule der Analytischen Philosophie gegangen, will die großen Begriffe ›der Mensch‹, ›die Freiheit‹ und eben auch ›die Erkenntnis‹ zuerst einmal analysieren. Manchmal will er sie auch einfach verwerfen. Zu welchen Schlussfolgerungen und Weiterentwicklungen diese unterschiedlichen Vorannahmen führen, kann man anschließend nachlesen.
Und dann noch das: Wie ehrlich soll man sein, wenn ein solcher Dialog abgeschlossen ist und man, wie das so ist, am Ende das Vorwort schreibt? Natürlich kann die Antwort auf diese Frage nur lauten: Man soll ganz und gar ehrlich sein! Nun denn, wenn wir das zur Maxime erheben, dann kommen wir nicht darum herum, auch noch das Folgende festzuhalten: Zwischendurch war da auf einmal die Idee, dass man, wenn wir schon spielerisch-grundsätzlich an das Thema ›Erkenntnis‹ herangehen wollen und die erzählende Literatur dabei wieder eine Rolle spielen soll – ja, dass man dann prüfen sollte, was sich wohl ergäbe, wenn zwei junge Frauen darangehen, zusammen einen Roman zu schreiben? Welche Rolle würden da Fragen der Erkenntnistheorie spielen? Natürlich waren wir uns von Beginn an der Risiken bewusst, die diese Idee in sich barg. Andere, denen wir von dem Vorhaben berichteten, hoben denn auch warnend den Zeigefinger: ›Nein, das geht heute, in einer Zeit, in der allein schon die Dreadlocks einer jungen weißen Frau das Schlagwort von der ›kulturellen Aneignung‹ auf den Plan rufen, ein Schlagwort, das anschließend durch die Zeitungen geht – nein, das mit den jungen Frauen geht auf keinen Fall!‹
Wir haben uns diesem Urteil gefügt. Fast. Im Kapitel ›Erkenntnisse im Roman‹ findet sich sozusagen die Hintergrundstrahlung dieser Idee. Und diese Hintergrundstrahlung folgt jener großen Frage der erzählenden Literatur, die da lautet: Kann man sich in andere Menschen und in ihre Sicht auf die Welt wirklich hineinversetzen?
Im Oktober 2023
Volker Ladenthin & Werner Zillig
Bücher – Flucht nach Bethlehem
Inhalt
Nach der Edition der Gedichte Jerry Cottons (2021) legt Volker Ladenthin mit diesem Band eine weitere Rarität vor: Die Übersetzung eines bisher unbekannten antiken Reiseberichts, der sich auf Ereignisse in Bethlehem um die Zeitenwende bezieht.
Auszug
1. In der flimmernden Ferne
In der flimmernden Ferne sah man schon Hütten und Stallungen, die zu Bethlehem gehörten. Bald würden wir ankommen. Es wurde auch Zeit. Nicht alle aus unserer Reisegruppe hatten die staubigen Wege, das trockene Gebüsch und die niedrigen Tamarisken gefreut.
Wir waren müde. Gestern Abend war es spät geworden. So manchen Becher hatten wir noch getrunken, als wir schon längst nicht mehr durstig waren. Und dann mussten wir früh los. Ohne die Dienerschaft. Wir hatten sie alleine nach Tyros geschickt. Es wurde für sie zu gefährlich. Wir waren, anders kann man es nicht nennen, auf der Flucht. Und ich war nicht ganz unschuldig daran.
2. Der Stier und die Zeder
Vor einigen Tagen waren wir, also ich, Der Große D und unsere drei Diener, mit einer Karawane, in der neben zwei bedächtigen Elefanten drei blau ver- hangene Sänften mitreisten, den Nil in Richtung Del- ta gezogen, und dann östlich abgezweigt zum [Sinai]. Wir wollten über Land zurück nach Athen. Endlich.
Am Abend des vierten Reisetages, wir hatten das fruchtbare Niltal noch nicht lange hinter uns gelaSsen, waren wir in einem Zeltlager eines Beduinenstammes angekommen. Es war geplant, dort über Nacht zu bleiben. Die etwas blöden Lasttiere hatten sich auch schon niedergekniet. Aber irgendetwas ließ uns Denkende zaudern. Auch die feinfühligen Elefanten trompeteten nervös.
Die Zelte der Nomaden waren von Öllämpchen trübe beleuchtet. Die windigen Unterkünfte wirkten verlassen. In der Mitte des Zeltlagers prasselte ein großes Feuer. Rauch und Funken stoben in den dunklen Himmel. Zahllose verschleierte Männer hatten um das Feuer herum drei Kreise gebildet, die gegeneinander liefen, der mittlere Kreis rechtsherum, die beiden äußeren Kreise linksherum. Ein Provinzorchester untermalte die Szenerie mit Trommeln und Flöten, und ein Chor sang düstere Klänge, wohl eher Laute als Worte.
»Lasst uns rasch weiterziehen«, raunte unser Karawanenführer jedem von uns leise ins Ohr, »sie feiern ihr Stierfest. Es kann gefährlich werden, wenn sie berauscht sind!«
»Von Gegorenem?«
»Von sich!«
Genau diese Bemerkung war es allerdings, die mich neugierig machte und Den Großen D wohl auch. Deiphantos Alexander, so hieß er mit Geburtsnamen, trug unseren Dienern auf, mit der Karawane weiterzuziehen. Wir kämen nach. Er wolle das Spektakel nicht verpassen.
Ich schlich mich langsam in die Nähe der tanzenden Männer. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie der Karawanenführer die letzten Dromedare zum Aufstehen antrieb. Er wollte schnell weiter. Die beiden klugen Elefanten hatten den Rand des Zeltlagers schon erreicht.
Deiphantos schob mich anstößig vorwärts in die Nähe der tanzenden Männer. Sie umringten einen Feuerkreis. Inmitten des Kreises stand auf einem hölzernen Gerüst ein goldfarbener Stier und glänzte im Feuerschein. Auf dem Stier saß im Frauensitz ein junges Mädchen. Die kurzen schwarzen Haare des Mädchens waren leicht gewellt, in der Mitte gescheitelt und wurden von einem gezackten Goldreif gehalten. Ein weites, blaues Tuch, das an der Borte breit türkis abgesetzt war, umhüllte locker seinen Körper. Seine Füße steckten in braun-weißen, nahezu golden schimmernden Sandalen.
Wir kannten Stiere aus Kreta. Dort ließen sich junge Männer im Tempelbezirk von wildgereizten Jungstieren auf die Hörner nehmen und in die Luft wirbeln. Echte Akrobaten.
Hier aber schien es anders. Hier war es ernst. Unter dem Stier lagen mehrere Lämmer und Zicklein, denen man die dünnen Beine zusammengebunden hatte. Sie zuckten und blökten, während sie langsam ausbluteten. Das Mädchen blickte teilnahmslos auf die Szenerie, als ob es berauschende Kräuter oder Pilze eingenommen hätte.
Immer schneller drehten sich die Kreise der tanzenden Männer gegeneinander. Manchmal stolperten einzelne Tänzer vor Schwindel oder Erschöpfung, fielen hin, wurden auf- und wieder mitgerissen, stolperten erneut, und dann ließ man sie außerhalb der Kreise unbeachtet liegen, bis sie wieder allein aufstehen konnten und sich einreihten. Die schwitzenden Trommler schlugen einen wilden Rhythmus, der sich noch zu steigern schien. Pam-Pam-O-Pam. Pam-Pam-O-Pam. Pam-Pam-Pam.
Bücher – Der Himmel über Tübingen
Inhalt
Ich lege hier in kleiner Auflage etwas vor, was ursprünglich ein Privatdruck war. Eine Auskunft in Bildern über den Himmel während meines Aufenthalts in Tübingen, im Oktober 2021. Dazu auch noch einige Bilder und Texte über den Aufenthalt in Göttingen, im November und Dezember desselben Jahres.
In meiner ›Göttinger Welt‹ trete ich nur als Koordinator auf. Diese Göttinger Welt besteht aus einer Reihe von Geschichten, die in einer alternativen Realität spielen, mit unterschiedlichen Verfasserinnen und Verfassern. Die Verbindungen zu dem, was wir gewohnt sind ›Realität‹ zu nennen, sind brüchig und unsystematisch.
Werner Zillig
Bilder aus der Kunsthalle Tübingen S. 31 ff. – Ausstellung MARINA ABRAMOVIĆ: »JENES SELBST / UNSER SELBST« 24.07.2021 – 13.02.2022 – Die Bilder aus der Marina-Abramović-Ausstellung sind aus Copyright-Gründen in dieser Download-Fassung nicht enthalten. Die Bilder in dieser Download-Fassung sind auf 150 dpi beschränkt, um die Datei nicht zu groß werden zu lassen.
Auszug
Die E-Book-Fassung dieses Büchleins bleibt im Format PDF, weil sich ein ›echtes E-Book‹ mit den vielen Fotos technisch nicht sinnvoll realisieren lässt. Der Altan Verlag bietet diese PDF-Fassung zum freien Download auf seiner Homepage an. Die Papierfassung ist normal über den Buchhandel und als Direktbestellung über den Verlag zu beziehen.
Werner Zillig
Inhalt
Kapitel 1
Der Himmel über Tübingen
Kapitel 2
Tübingen und Umgebung
Kapitel 3
Göttingen
Kapitel 4
Die Göttinger Welt
Kapitel 5
Nachbemerkungen
Bücher – Zeitenbruch
Inhalt
Almut Schüz schreibt: „Im Jahr 2020 konnten wir das 30jährige Jubiläum der Wiedervereinigung Deutschlands feiern. Im August 2021 jährte sich ein anderes historisches Ereignis zum 30. Mal: der Putsch gegen Gorbatschow. Gegen den Mann also, dem wir die Wiedervereinigung verdanken.“
Weitere wichtige politische Ereignisse fielen in die Zeit ihres Aufenthalts. – Dies ist der lebendige Bericht einer Wissenschaftlerin, die jenen „Zeitenbruch“ miterlebt hat.
Angesichts des heute drohenden Wiederaufflammens des Kalten Krieges hat dieser Blick nach Osten und – mehr noch – der Blick aus dem Osten auf den Westen nichts von seiner Aktualität verloren.
Auszug
Vorfreude auf das Land der Perestroika
Sonntag, 18. August 1991
Immer wieder öffnet sich die Wolkendecke unter uns und gibt den Blick frei auf die Ostsee. Gelegentlich überfliegen wir noch Fetzen von Land und rechts erahnt man eine Weile den sandigen Streifen der polnischen Küste. Dann fliegen wir übers offene Meer.
Acht Jahre sind vergangen seit meinem letzten Besuch in Leningrad, im Herbst 1983. In der Welt sind seither Dinge passiert, die man sich nicht erträumt hätte. Der Kalte Krieg ist beendet, der Eiserne Vorhang gefallen. Eine Utopie ist Wirklichkeit geworden: Führer der westlichen Welt und der Sowjetunion sind persönliche Freunde geworden. Beide Seiten haben ernsthaft begonnen, abzurüsten. Der Warschauer Pakt besteht nicht mehr. Die Mauer ist gefallen. Nur noch ein Deutschland ist auf der Landkarte. Niemand mehr spricht von einem dritten Weltkrieg. Und all dies ist mit einem Namen verbunden, dem eines Mannes, der den Mut besessen hat, in einer gefährlich verfahrenen Situation als erster die Waffen zu senken,1 und der die Stärke besessen hat, die Schwächen des eigenen Systems offenzulegen und tiefgreifende Veränderungen zu erwirken. Aus dem Land der KPdSU und des KGB ist das Land der Glasnost und Perestroika geworden.
Dieses Land werde ich nun wiedersehen, das Land Gorbatschows, in dem sich so viel geändert hat, und die erinnerungsträchtige Stadt, die in mir so viele Fragen aufgeworfen hat, in der ich gelacht, geweint und viele Abende lang sinniert habe. Damals war die Sowjetunion ein durch und durch kommunistischer Staat gewesen; Andropow war an der Macht. Die Welt befand sich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. In Deutschland demonstrierten damals Hunderttausende gegen den Beschluss der NATO, Pershing-II-Raketen zu stationieren. In der Sowjetunion bedrohten die SS-20-Raketen den Westen. Reisen durch den Eisernen Vorhang waren eine seltene Angelegenheit. Auch die Wissenschaft in Ost und West bewegte sich weitgehend in getrennten Welten. Und am 1. September 1983, kurz vor meiner damaligen Einreise nach Leningrad, war eine Passagiermaschine der Korean Air Lines durch einen sowjetischen Abfangjäger westlich der russischen Insel Sachalin abgeschossen worden. 269 Menschen waren umgekommen. Die Emotionen auf beiden Seiten kochten hoch.
Für mich als Westdeutsche war es damals, 1983, eine einzigartige Gelegenheit gewesen, nicht nur ein anderes Land kennenzulernen, sondern auch ein gänzlich anderes politisches System. Vor allem aber hatte es mir auch die Möglichkeit gegeben, mit den Augen des vermeintlichen Gegners einen Blick auf den Westen zu werfen. Das war eine prägende Erfahrung. Sie war jedoch eingeschränkt durch die Erkenntnis, dass es unmöglich ist zu wissen, was ›der Gegner‹ wirklich denkt, wenn er dies nicht selbst preisgeben will. So bin ich gespannt, ob ich jetzt, im Land der Glasnost, Antworten auf meine unausgesprochenen Fragen von damals bekommen werde.
Bei meinem damaligen Flug war ich ein wenig mit meinem Sitznachbarn ins Gespräch gekommen, einem finnischen Ingenieur, der dienstlich unterwegs war. Ich erinnere mich wieder an seinen Satz: »Meiner Ansicht nach ist Leningrad die schönste Stadt der Welt. Sie ist etwas ganze Besonderes.« Dem konnte ich nach meinem Aufenthalt zustimmen und ich freue mich auf die Stadt, die mir in den damaligen Wochen zu einer zweiten Heimat geworden ist, und auf die Kollegen, die zu Freunden geworden sind.
Die Wolkendecke hat sich geschlossen. Wie auch beim letzten Mal greife ich zum Lexikon, um mir Sätze zurechtzulegen. Wie würde ich diesmal empfangen werden? Was für ein Gefühl hat mein erster Besuch wohl hinterlassen? Ich könne bei ihr wohnen, hat meine Kollegin Sonja am Telefon gesagt. Die Universität habe nicht mehr die Mittel, mich – wie beim letzten Mal – im Hotel unterzubringen. Ich freue mich auf diesen privaten Kontakt.
Am Spätnachmittag landen wir auf dem Flughafen Pulkowo, in der lauen Luft des nordischen Sommers.
Bücher – Der Fall Gottfried Bürger
Inhalt
In den Jahren 1992 und 1994 gab es in Göttingen zwei Morde, die beide von der Polizei nicht aufgeklärt werden konnten und die beide mit großer Wahrscheinlichkeit miteinander in Beziehung stehen. Nachdem die Psychotherapeutin Dr. Dagmar Perutz im September 1992 ermordet worden war, wurde Gottfried Bürger am 8. Juni 1994 in seiner Wohnung in Göttingen tot aufgefunden. Klar ist, dass sich Dagmar Perutz und Gottfried Bürger gekannt haben.
In der vorliegenden Rekonstruktion durch den Göttinger Internisten Christoph L. Althof, einen Freund Bürgers, wird eine von zwei Erklärungen der Mordfälle durchgespielt. Das vorliegende Buch ist die Version A dieser Recherche, der die Version B folgen soll.
Auszug
Das Rätsel
Gottfried Bürger genoss diesen Donnerstag Nachmittag im Sommer 1992 auf dem Balkon mit schlechtem Gewissen, denn eigentlich hätte er in der Wohnung sitzen und Seminararbeiten korrigieren müssen. Aber er saß da, unter dem Sonnenschirm, zurückgelehnt, den Roman, den er seit drei Tagen las, auf dem Schoß und ein Glas Weißwein vor sich auf dem Tisch. Er wollte an diesem Nachmittag einfach nicht mehr aufhören zu lesen.
Als das Telefon in der Wohnung läutete, hatte Bürger Angst, es könnte das Dekanat oder das Prüfungsamt sein. Er hörte schon die vorwurfsvolle Stimme einer Sekretärin, die irgend etwas von ihm wollte. Die Klausuren seien noch nicht da, oder das Gutachten für die Magisterarbeit der Frau Soundso müsste schon seit mehr als ei- ner Woche vorliegen.
Bürger ging in die Wohnung, nahm den Hörer ab, und er war sich einen Moment lang sicher, dass der Anrufer soeben aufgelegt hatte. Er hörte nichts. Er sagte zur Sicherheit noch einmal laut »Hallo!«
Mit einer kleinen Verzögerung antwortete jetzt eine Frauenstimme. »Hallo!« Die Stimme schwieg wieder.
Bürger dachte nach. Die nächste Frage, die ihm in den Kopf kam: War das eine Frau, die er vor vielen Jahren einmal gekannt hatte und die herausfinden wollte, ob er sich noch an ihre Stimme erinnerte?
Dann sprach die Frau weiter: »Sie kennen mich nicht. Ich bin – eine Ihrer Leserinnen, Herr Bürger. Eine Leserin, die auf Ihren neuen Roman wartet.« Die Frau lachte an dieser Stelle leise. »Sie sollten die Geschichte von Paul Schwarz zu Ende schreiben.«
»Woher wissen Sie, was ich gerade schreibe?«, fragte Bürger ohne nachzudenken.
»Das ist, glaube ich, nicht so wichtig«, antwortete die Frau.
Bürger schaltete um. Dieses Gefühl des Umschaltens hatte er immer, wenn er mit Vorsatz und gegen den unmittelbaren inneren Impuls etwas Bestimmtes tat. Er wollte den kleinen Ärger, der in ihm aufstieg, nicht in seine Stimme dringen lassen, sondern freundlich sprechen. Er wollte nicht ungeduldig klingen.
»Wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind?«, fragte er. Er sprach jetzt wie ein geschulter Polizeibeamter, der weiß, dass Geduld immer das Beste auf dem Weg zu guten Verhörergebnissen ist.
»Nein«, erwiderte die Frau. »Nein. Wenn ich das wollte, hätte ich mich gleich mit meinem Namen gemeldet. Es ist besser, wenn Sie nicht wissen, wer ich bin.«
»Und warum wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind.«
»Da gibt es viele Gründe. Jeder einzelne dieser Gründe würde in Ihren Ohren sehr merkwürdig klingen. Sagen wir darum: Ich möchte die Spannung steigern. Ich bin für Sie einfach – nun, ich bin wichtiger für Sie, wenn Sie nicht wissen, wer ich bin.«
Die Frau machte eine Pause. Bürger hört, wie sie sich räuspert. Dann sagte sie langsam: »Erinnern Sie sich an Ihr Leben gegen Ende der Pubertät? Sie haben wie in einem Rauschgefühl darauf gewartet, dass Sie jetzt erwachsen werden. Sie haben damals zu sich selbst gesagt: ›Ich werde leben, wie die Menschen in Romanen leben und gelebt haben.‹«
Er wollte antworten, aber er hörte das Klicken. Die Frau hatte aufgelegt.
Bürger ging hinaus auf den Balkon, setzte sich, trank einen Schluck Wein und nahm das Buch auf, das er las. Es war ein Roman von Julian Barnes, ›The will to let the world end«. Er hatte den Bleistift zwischen die Seiten gelegt und wendete jetzt die Seite, um weiterzulesen.
Der Abschnitt auf der neuen Seite begann mit diesen Sätzen: »I remember a period in late adolescence when my mind would make itself drunk with images of adventurousness. This is how it will be when I grow up. I shall go there, do this, discover that, love her, and then her and her and her. I shall live as people in novels live and have lived.«
Bürger legte das Buch auf den Tisch zurück, stand auf und sagte halblaut: »Das ist jetzt nicht wahr! Woher konnte diese Frau wissen …«
Bücher – Jerry Cotton Gedichte
Inhalt
Hier entstehen Stimmungen, die man zwar am Schreibtisch verschriftlichen, aber nicht finden kann. Und die man nicht erfinden kann. Geschrieben aus einer existenziell dichterischen Haltung zur Welt, die es sich nie leicht macht: »Jede Frage bedeutete für mich echte Qual.« (Volker Ladenthin)
Auszug
Nicht die geringste Kleinigkeit
In den Hinterhof drang
auch um diese Tageszeit
kein Sonnenstrahl.
Mülltonnen standen
herum, eine davon
umgekippt.
In einer Ecke türmte sich
Schrott, an den Rückfronten
der Häuser mit ihrem Gewirr
eiserner Feuerleitern
klebten ein paar verfallene Schuppen.
Eine Frau, die
Kartoffelschalen
in den Hof warf.
Ebenso
Das Haus war kaum mehr als eine Ruine.
Es sah aus, als hab es seinen Einsturz schon
für die nächsten vierzehn Tage vorgesehen.
Die Tür zur Straße ließ sich nicht mehr schließen,
geschweige denn absperren.
Die hölzerne Treppe, die hinaus zu den
oberen Stockwerken führte,
wackelte wie die Planken eines morschen Bootsstegs,
im hölzernen Geländer fehlten Sprossen.
Der Boden war bedeckt
mit einer dichten Schicht Staub und Kalk,
der von der Decke gefallen war,
darin geringe Spuren von Farbe,
die von den Wänden bröckelte.
Taubenkot in der Schmutzschicht auf dem Boden.
Neben der Tür ein Emailleschild, das
in seinem langen Leben
Schläge abbekommen hatte.
Der Name Higgins war zu entziffern
in einer Schrift, die schon vor 50 Jahren
altmodisch gewirkte haben musste.
Wer dieser Higgins war,
wusste kein Mensch mehr.
Obdachlose lebten hier,
bis sie an einer Überdosis Kokain starben.
Drei Wochen später waren sie ebenso
in Vergessenheit geraten
wie Mr. Higgins.
Hurrikangeheule
Die Kaschemme verriet sich
durch schreiende
Neonreklame und durch ein
Jazzgeheule, das zwei
Straßen weit zu hören war.
Gruppen
von Jugendlichen
standen
vor dem Laden
herum, nicht nur
junge Neger,
sondern auch Weiße. Auch Girls
befanden sich
darunter.
Als wir die Tür aufstießen,
umheulte uns der Jazz
wie ein Hurrikan.
Bücher – Das Nächtebuch
Inhalt
In einer neuen Romangattung führt Hartwig Eckert den Leser aus dem Reich der Macher in Hoffmanns Palast der Worte.
Auszug
That’s the way to go, sagen die Briten anerkennend dazu. Der von ihm nicht abgebrochene Scheibenwischer bewegte sich auch ohne Scheibe hin und her, so dass seine einzige Funktion nun darin bestand, seinem toten Herrn auf den Rücken zu klopfen.
Während ich von der Straßenseite nach dem Mann griff, fasste ihn von der Bürgersteigseite vorsichtig eine Frau an. Wie wir beide vornübergebeugt dastanden, uns eine Sekunde lang durch einen Blick zu behutsamem Vorgehen verständigten, erhellte uns ein Blitzlicht: Zwei engelsgleiche Helfer, einem armen Sünder auf seinem Götzenaltar zur Seite stehend.
***
War es das Fehlen des abgehackten Körpers oder waren es die beiden von der Decke hängenden nackten Füße, aus denen die Knochen herausragten, die mir die Sprache nahmen? Ich blickte auf Ljudmilla, meine Zeugin neben mir, die diesen Anblick später nie bestätigt hat. Wir standen in einem ehemaligen Schlachthof, in dem Fleischerhaken von der Decke hingen.
»Seht genau hin, ihr beiden«, sagte einer der drei Männer, die uns hierher geführt hatten, und die ich aus dem Bistro nach dem Unfall kannte.
Als ich den Blick wieder zur Decke wandte, erschrak ich über seine genaue Einschätzung meiner Beobachtungsgabe, denn erst jetzt bemerkte ich, dass dort zwei linke Füße hingen und der kleinere vermutlich der einer Frau war. Noch Jahre danach konnte ich keine ungleichmäßigen Schritte hören ohne die grauenvolle Vorstellung eines grotesk hinter mir hinkenden Paares. Aber mit viel größerer Wahrscheinlichkeit steckten die beiden rechten Füße irgendwo auf dem Meeresboden in Zementblöcken.
»Es ist eigentlich noch zu früh«, sagte einer der Männer, und ich hoffte, dass diese Bemerkung die Reaktion auf den Blick zur Uhr eines der beiden anderen gewesen war.
»Hast du dich jetzt satt gesehen?«, fragte mich der mit hoher Stimme und flacher Stirn. »Dir hat’s die Sprache verschlagen, was, Junge? Stumm wie ein Fisch.« Er wandte sich grinsend an die anderen: »Und wo gehören Fische rein?« Wie auf ein Kommando packten mich die drei an den Haaren und steckten meinen Kopf in einen Wassertrog, der bei dem Gerangel seinen Inhalt so weit verschüttete, dass ich bald darin atmen konnte. Als sich Hören und Sehen wieder einstellten, sagte der eine zu meiner Begleiterin: »Hallo Luja, mein Schatz. Also dein neuer Beschützer gefällt mir: Er ist so verschwiegen. Sieh zu, dass es so bleibt. Und nun verschwinde.« Er gab ihr einen Schlag auf den Hintern, als wolle er ein Pferd auf die Weide entlassen. »Nimm deinen Wasserkopf hier mit, er kann sich ja draußen noch ein wenig verschnaufen. Morgen darf er seine Sprache wiederfinden, aber ein falsches Wort vor Gericht und ihr baumelt von der Decke wie die Fledermäuse. Nun haut ab, ihr beiden Turteltauben.«
Nicht einmal als wir draußen alleine waren, gestattete ich mir den Gedanken, seine Vergleiche hinkten.
»Es hat mich gefreut, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Ljudmilla, aber ich fürchte …«
»Du kommst hier nicht mehr raus, ich habe es auch schon versucht.« Ich fand ihren Akzent auf einmal befremdlich, konnte aber nicht weitergehen, weil sie sich vor mich stellte, um mir Gesicht und Hals zu trocknen und dann auch noch mein feuchtes Haar mit ihren Fingern sehr sorgfältig zu ordnen. Als wir weitergingen, sah ich, dass unsere vier nassen Fußabdrücke bei dieser Prozedur ineinander verlaufen waren.
»Du kannst jetzt nicht mehr aussteigen. Die drei bestehen darauf, dass du vor Gericht aussagst.«
Bücher – Zielverführung
Inhalt
Wir investieren Milliarden in das Gesundheitswesen und erhöhen die Zahl der Kranken.
Wir bewirken mit Friedensmissionen Kriege, Bürgerkriege, Terroraktionen.
Fünf Professoren haben sich zusammengetan, um der Frage nachzugehen, warum wir in komplexen Systemen – also allen gesellschaftspolitischen – unter großem Aufwand das Gegenteil von dem erreichen, was wir als Ziel definiert haben.
Auszug
Inhalt
Kapitel 1
Einfache Wege in komplexe Desaster Hartwig Eckert
Kapitel 2
Warum sind wir so tüchtige Idioten? Jose Julio Gonzalez
Kapitel 3
Pläne machen: Die Fehlermaschine und wie man sie abstellt Dietrich Dörner
Kapitel 4
Krankheit unser höchstes Gut Ines Heindl
Kapitel 5
Die Schwarze Königin: Wettrennen, bis es keine Ziele mehr gibt Hartwig Eckert
Kapitel 6
Die antitelische Tragik der Allmende: Von den Welt-Fischgründen zu den EU-Pfründen Jose Julio Gonzalez
Kapitel 7
Kompetenzfestung oder Zuflucht für Millionenheere Gunnar Heinsohn
Kapitel 8
Zielweisheit gewinnt man durch Fragen Dietrich Dörner, Hartwig Eckert, Ines Heindl, Gunnar Heinsohn, Jose Julio Gonzalez
Vorwort
Es gibt nichts Wichtigeres, als bei Projekten die Ziele klar zu definieren. Es gibt nichts Nachteiligeres, als genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was als Ziel angestrebt wird. Zur Analyse dieser beiden Pole haben wir die Begriffe „telisch“ und „antitelisch“ geprägt. In allen dynamisch-komplexen Systemen ist antitelisches Verhalten paradoxerweise nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.
Wir heutigen Menschen leben in einer vernetzten, globalisierten Welt, in der Maßnahmen immer zahlreiche Nebenwirkungen und langfristige Folgen haben. Für die Evolution war diese rasante Entwicklung zu kurz, um in Homo sapiens genetisch verankerte neuartige Denkfähigkeiten hervorzubringen. Die Denkmuster, mit denen wir ausgerüstet sind, reichen aus für Detail-Komplexität, wirken jedoch bei dynamischer Systemkomplexität so, dass genau das Gegenteil des angestrebten Ziels erreicht wird. Die Lösung sehen wir in heuristischen Methoden zur Erkennung dieser Muster und in Denk- sowie Handlungsstrategien zur Überwindung des Dilemmas, dynamische Komplexität mit linearen Denkmustern lösen zu wollen.
Uns geht es nicht primär darum, welche Politiker bzw. andere Stakeholder unserer Gesellschaft „Recht haben“, sondern um die Fragen, welche Ziele sie definiert haben und ob dabei die wichtigsten Variablen einbezogen wurden, auch die der Vernetzung, Langzeiteffekte und Nebenwirkungen. Wie kann man Politiker und andere Entscheidungsträger dazu bewegen, dass sie Ziele klar definieren und sie anschließend verfolgen, statt sich von ihnen zu entfernen? Wir brauchen „Zielweisheit“.
Bücher – Graff
Inhalt
Vom Elsaß über Venedig und Albanien führt die Spur, die Graff verfolgt, bis in den Nahen Osten. Er wird nicht nur mit der harten und zugleich faszinierenden Welt der orientalischen Minderheiten konfrontiert, sondern stößt auch auf das Vermächtnis von Assassinen und Templern, das unter jüdischen Kabbalisten, christlichen Kopten und Maroniten sowie muslimischen Drusen und Alewiten weiterlebt.
Auszug
Prolog
Frankreich im Jahr 1995. Eine Serie islamistischer Terroranschläge erschüttert das Land – Beginn einer Welle blutiger Gewalt, die über New York, Madrid und London zwanzig Jahre später nach Paris zurück schwappt. Die Reaktion der Staatsmacht ist immer gleich hilflos: »Kriegserklärung« an einen unfassbaren, wie aus dem Nichts zuschlagenden Gegner; hektischer Aktionismus ohne Sinn und Verstand; Beruhigungspillen für die aufgeschreckte Bevölkerung, ohne den Dingen auf den Grund zu gehen.
Letzteres versucht im Straßburg der neunziger Jahre der Gendarmerie-Oberst und Kommissar Jean-Jacques Graff, der mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus beauftragt ist. Den Dingen auf den Grund gehen heißt damals wie heute, sich für Unerklärliches zu öffnen, Mysterien zu ergründen versuchen und sich tief in der Vergangenheit wurzelnden Erkenntnissen nicht zu verschließen, die möglicherweise mehr Erfolg beim Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner versprechen als kriminalistische Routine und politische Worthülsen. Den Dingen auf den Grund gehen heißt auch, die verwerflichen Verstrickungen der Mächtigen im Orient wie im Okzident beim Namen zu nennen, ihre Lügengespinste zu zerstören und die Augen zu öffnen für diejenigen, die seit Jahrhunderten von den einen unterdrückt, von den anderen im Stich gelassen werden: den orientalischen Minderheiten, die heute mehr denn je von der Auslöschung bedroht sind. Für sie und ihren unbeugsamen Widerstand und Überlebenswillen soll dieser Roman ein Zeichen setzen.
Geschrieben wurde er schon Ende der 1990er Jahre, als noch kaum jemand die Schrecken erahnte, die wenig später über die Welt diesseits und jenseits des Mittelmeers hereinbrechen sollten.
Der Garten Europas
Das Land liegt satt und zufrieden zwischen dem großen Fluß und den blauen Bergen. In der Ebene schleichen sich Bäche und Rinnsale durch endlose Maisfelder dem Fluß entgegen. Kümmerliche Reste des einstmals prächtigen Riedwaldes künden von Zeiten, wo der Mensch die Ebene noch nicht in sich hineingefressen hatte. In das hügelige Weinland unterhalb der Berge traute er sich schon früher. Das sieht man den Puppenstädtchen an, die sich am Eingang von Tälern zu verstecken suchen, ohne doch dem Strom der Touristen entrinnen zu können, so wie sie schon früher hilflos den durchziehenden Heerscharen ausgeliefert waren. »Mein schöner Garten«, rief der Sonnenkönig aus, als er an der Spitze einer solchen Heerschar das fruchtbare Land vor sich liegen sah, und vergaß dabei, daß er diesen Garten mitsamt seinen Bewohnern den früheren Eigentümern geraubt und abgepreßt hatte. Garten Europas nannte es fast dreihundert Jahre später ein Dichter, der ein rechtmäßiger Bewohner dieser Landschaft war, aber den größten Teil seines Lebens im Exil verbrachte. Er hatte dummerweise geglaubt, das kleine Land, zwischen zwei großen Mächten mitten in Europa gelegen, könnte eine Brücke zwischen den feindlichen Brüdern sein, der Humus, auf dem die Früchte des Verstandes und der Versöhnung wachsen und gedeihen.
Weil ihn die Gnade eines frühen Todes ereilte, mußte der Dichter René Schickele nicht mehr mit ansehen, wie seinem kleinen Land das zweite schwere Unglück innerhalb von drei Jahrhunderten widerfuhr, von den vielen kleinen Unglücken in Gestalt von Kriegen, Raubzügen, Verfolgung, Unterdrückung und Not einmal abgesehen, die aufeinanderfolgten wie die Nacht dem Tag. Hatte in jener endlos scheinenden Schlächterei, die man in den Geschichtsbüchern pompös und verharmlosend als Dreißigjähriger Krieg bezeichnet, mehr als die Hälfte der Bewohner das Leben eingebüßt, so verloren später die Überlebenden der nazistischen Barbarei ihre Seele. Der Schock der erlittenen Vergewaltigung durch die braunen Horden war so groß, daß sie nach dem Krieg ohne zu zögern anfingen, ihre eigenen Wurzeln herauszureißen, um für immer dem Zwiespalt zwischen germanischer Seele und lateinischem Herzen zu entrinnen. So gedachten sie zu einer normalen Provinz des einen Vaterlandes zu werden und nahmen den fortdauernden Spott ihrer Landsleute von jenseits der Berge ob ihres schweren Akzents und ihres ebenso schweren Essens in Kauf, weil sie genau wußten, daß man spätestens ihre Enkel nur noch am Namen, nicht mehr aber an der Aussprache erkennen würde. Was aber bedeuteten Namen in einem Land, das einstmals ferne Kontinente beherrschte und heute noch überseeische Territorien sein eigen nannte, deren Bewohner vollwertige Staatsbürger waren? Ein Land, das im Namen der Revolution die hehren Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der Welt verbreitet hatte und das deswegen bis zum heutigen Tage das Ziel unzähliger Verfolgter und Unterdrückter war?
So wurde denn auch die Geduld der kleinen Provinz und ihrer eifrigen Bewohner eines Tages von dem republikanischen Monarchen im fernen Elysée-Palast belohnt. Er gewährte dem Land zwischen Strom und Bergen, wie auch den übrigen Teilen seines Reiches, nach zweihundert Jahren des strengsten Zentralismus ein wenig Eigenständigkeit und das Recht, den alten Namen zu führen.
Die kleine Provinz Elsaß hatte in ihrer Geschichte Schlimmes durchgemacht; sie war Durchgangsland für fast alle Kriegszüge der europäischen Geschichte, und wer dort wohnte, dem war es gleichgültig, durch welches Schwert er ins Jenseits befördert wurde. Römer, Alemannen, Franken, Hunnen, Kreuzritter, Fürsten, Prälaten, Raubritter, Spanier, Franzosen, Kroaten, Schweden, Österreicher, Jakobiner, Preußen, Nazis – das alles zog hin und her, eroberte, plünderte, schlug sich, verwaltete und setzte sich mal länger, mal kürzer fest. Im Herzen Europas zu liegen brachte zwar manchen Vorteil – die Wirtschaftsströme kreuzten sich hier ebenso wie die Kriegsströme, und einmal konnte sich die kleine Provinz sogar rühmen, Mittelpunkt des europäischen Geisteslebens gewesen zu sein – aber alles in allem war es doch eine rechte Last, immer und jedem im Wege zu stehen.
In einem Punkt allerdings erwies sich die Geographie als Verbündete des Landes und seiner Bewohner. So sehr man unter den Bruderkämpfen der Nachbarvölker und ihrer Verbündeten litt, so wenig war man von den großen Bedrohungen der Jahrhunderte berührt. Nur am Anfang hatten die Hunnen auf dem Weg in ihr Verderben auf den Katalaunischen Feldern das Land gestreift. Danach waren die Invasoren alle auf dem Weg in das Herz Europas weit vorher zurückgeschlagen worden, die Ungarn, die Wikinger, die Mongolen. Und vor allem die jahrhundertelange Bedrohung durch islamische Mächte war spurlos am Elsaß vorübergegangen. Der Ort der ersten Entscheidungsschlacht bei Tours, als die aus Spanien vordringenden Araber in letzter Minute von den Franken gestoppt wurden, lag fünfhundert Kilometer von Straßburg entfernt. Und Wien, wo achthundert Jahre später die zweite und nach weiteren einhundertfünfzig Jahren die dritte Entscheidungsschlacht gegen die Türken geschlagen wurde, war noch weiter weg. Einzig im 9. Jahrhundert gelangte ein sarazenischer Stoßtrupp in bedrohliche Nähe, verlor sich dann aber in den Alpentälern der Schweiz.
Doch jetzt, nachdem man fester und unverbrüchlicher Bestandteil des einen Vaterlandes geworden war, und dieses wiederum sich mit seinem mächtigen Nachbarn im Osten ausgesöhnt hatte, ja, mit diesem zusammen sogar das Herz und die Seele Europas bildete, jetzt war diese Bedrohung auf einmal da. Sie war schleichend daher gekommen, niemand hatte sie bemerkt, keiner wußte zu sagen, wann es angefangen hatte, alle – die politischen Führer wie immer an vorderster Stelle – hatten die Gefahr nicht sehen wollen. Und doch waren sie es, die Schuld daran trugen, die im Namen der Nation das Volk zu fernen Abenteuern getrieben hatten und die immer noch an fremden Ufern versuchten, undurchsichtige Geschäfte zu betreiben, deren Gewinn in ebenso undurchsichtigen Taschen versickerte. Doch mit dem Gewinn sickerten auch die Opfer der unheiligen Allianzen in die Metropole ein, überschwemmten die Vorstädte, breiteten sich in ganzen Straßenzügen aus, eröffneten Gemüseläden und Schneidereien, Restaurants und Reisebüros, und schließlich sogar Schulen und Gebetsstätten. Frauen mit Kopftüchern und Kinder mit dunklen Augen beherrschten tagsüber lärmend die Straßen, die abends von ernsthaft diskutierenden bärtigen Männern belebt wurden, während nachts die Mächte der Finsternis das Kommando übernahmen. Die Polizei wagte sich nach Anbruch der Dunkelheit in manchen Städten nicht mehr in bestimmte Viertel: Drogen, Waffen, religiöser Fanatismus und politische Intrigen lagen wie eine dunkle Wolke über dem lichten Land. Wie eine langsam steigende Flutwelle nach lang anhaltendem Regen breitete sich die Bewegung von Süden nach Norden aus. Von Marseille nach Lyon und von dort in die elenden, dem Untergang geweihten alten Industriegebiete des Nordens um Lille und Roubaix schuf sie sich immer mehr Vorstädte des Islam, wie ein kluger Soziologe das nannte. Die Metropole Paris war von alters her Anlaufpunkt der Mühseligen und Entrechteten, zuerst um den Gare du Nord, Endpunkt für polnische und russische Emigranten, dann sich ausbreitend in die häßlichen Betonviertel der Vorstädte im Norden und Osten der Stadt. Und während dieser Strom den gleichen Weg nahm wie über tausend Jahre zuvor die Araber aus Nordafrika und Spanien, ergoß sich zur gleichen Zeit ein ähnlicher Strom aus dem östlichen Mittelmeer auf dem Weg der türkischen Invasoren in die Mitte Europas.
In der kleinen Provinz Elsaß trafen sich die beiden Ströme – so wie sich schon immer die Ströme der Zeit in diesem Zwischenland getroffen hatten.
* * *
Warum nur kommen die alle zu uns? fragte sich der Kommissar-Oberst Jean-Jacques Graff in seinem Büro in der Avenue des Vosges, dessen hohe Fenster einen geradezu kitschigen Postkartenblick auf den Straßburger Münsterturm freigaben. Dort stand er oftmals während der langen Bürotage, weil er beim Nachdenken gerne aus dem Fenster blickte. Aber er erfreute sich auch an dem Anblick, den der sich nach oben immer mehr verjüngende Turm bot, und er stellte sich die darunter liegende dunkle, Respekt heischende Masse des Querhauses vor, das von den steilen Dächern der Altstadt verdeckt wurde. Dieser Anblick bewies ihm mehr als alles andere, daß er tatsächlich zurückgekehrt war nach zwanzig Jahren, in denen er in immer der gleichen Uniform und in stets gleichförmigen Büros die Staatsgewalt in fast allen Winkeln der Republik repräsentiert hatte. Jetzt hatte ihn das gütige Schicksal der bürokratischen Rotationsmaschinerie an die Stätte seiner Kindheit zurück katapultiert, und er war entschlossen, seine Wurzeln wiederzufinden, die der jakobinische Zentralismus mit Macht und Verführung zu untergraben suchte. Hatte er nicht zu Hause mit seiner Frau immer im heimatlichen Dialekt gesprochen, so daß seine Kinder ihn wenigstens verstanden, auch wenn sie sich sonst in nichts von anderen französischen Kindern unterschieden, vom fremd klingenden Familiennamen einmal abgesehen?
Und jetzt das. Vor ihm lagen zwei Papiere. Das eine war ein Zeitungsartikel aus den Dernières Nouvelles d’Alsace vom selben Tag. Unter der Überschrift RANDVIERTEL: DIE SPANNUNG STEIGT konnte er lesen:
Seit letztem Wochenende wurden ein Dutzend Autos gestohlen und in den Randvierteln von Strasbourg, vor allem im Neuhof, willentlich in Brand gesteckt. Gruppen Jugendlicher zünden Autos oder Papierkörbe an und empfangen dann die Feuerwehr mit Steinwürfen.
Sie tun das aus dem Hinterhalt heraus und hindern so die Hilfskräfte daran, sich dem Brandherd zu nähern. Seit Anfang des Jahres 1995 kamen die Feuerwehrleute so bei 320 Brandstiftungen von Autos in und um Strasbourg zum Einsatz. Die Gesamtzahl der in Brand gesteckten Wagen dürfte bei 450 liegen.
Die Straßburger Transportgesellschaft (CTS) hat ihrerseits in den Monaten August und September elf Angriffe von Busfahrern und Kontrolleuren registriert. Insgesamt konnten seit Jahresbeginn 51 Angriffe aufgelistet werden. 1994 waren es 48. Von Januar bis September wurde außerdem 108mal mit Steinen auf die Busse geworfen. Im Monat September allein 20mal.
Der Kommissar ärgerte sich über den Artikel, weil er in kläglichem Deutsch geschrieben war. Dabei kaufte er doch immer die zweisprachige Ausgabe der DNA, weil er dabei helfen wollte, das Verschwinden der Muttersprache zu verhindern. Nach wochenlangem Zögern tat er dies jetzt auch offen vor seinen Kollegen, nachdem er festgestellt hatte, daß die offizielle Linie nunmehr die Bilingualität förderte. Doch wußte er, daß er zusammen mit 40.000 weiteren Käufern auf verlorenem Posten stand, denn fünfmal so viele zogen es vor, die rein französische Ausgabe zu erstehen. Vor fünfundzwanzig Jahren wurde noch die Hälfte der Auflage zweisprachig gedruckt – so wenigstens stand es in einem (natürlich französischen) Buch über die Kulturgeschichte des Elsaß, das er erst kürzlich voller Wehmut gelesen hatte.
Er ärgerte sich aber auch darüber, daß diese Typen schon wieder in den Schlagzeilen waren. Sie waren nur kleine Fische – nein, sie waren weniger als das, und doch viel mehr: Sie waren das Wasser, in dem sich die größeren, die Raubfische tummelten. Aber das interessierte niemanden. Die Öffentlichkeit würde bald wieder über ihn herfallen, wegen dieser läppischen Vorkommnisse und dieser armseligen Typen. Als erster würde ihn der Präfekt anrufen, um ihn an seine Verantwortung als Chef der Kommandogruppe der Nationalgendarmerie zu erinnern. Der Präfekt würde sagen, daß der Innenminister ihm durch einen Anruf aus Paris schon am frühen Morgen das Frühstück verdorben habe, und er somit keinerlei Hemmungen habe, nun seinerseits dem Kommissar den Tag zu verderben. Dieser würde sich in den Sessel zurücklehnen, den Hörer in einiger Entfernung vom Ohr halten, um nur in Wortfetzen den üblichen Sermon mitzubekommen: … Verantwortung … Staatsautorität … Öffentlichkeit … Minister …
Während er auf den Anruf wartete, starrte er mit müden Augen auf das zweite Papier, das in fehlerhaftem Französisch geschrieben war. Der Bericht stammte von einem V-Mann aus dem Vorort Neuhof, wo letzte Nacht die Randale stattgefunden hatte und der zu jenen Vorstädten des Islam in Frankreich gehörte, über die immer mehr Bücher geschrieben wurden. Aber alle diese Bücher konnten auch nur das beschreiben, was ohnehin jeder wußte: daß die Hälfte der Leute arbeitslos war, daß die Jugendlichen keine Chance hatten, daß sie das System haßten, daß sie ihr sinnloses Dasein als Galeere bezeichneten, daß diese Ghettos der Nährboden für Extremismus aller Art waren. Aber dann kamen diese intellektuellen Klugscheißer unweigerlich jedesmal zu dem Schluß, daß die Gesellschaft Schuld an diesem Zustand sei, weil sie vor allem den Jugendlichen die Integration verweigere und sie deswegen ihre Identität im islamischen Fundamentalismus suchten.
Der Kommissar lächelte bitter vor sich hin. Was glaubten diese Typen eigentlich, und was suchten sie hier? Wenn sie ihre Identität bewahren wollten, dann sollten sie doch dorthin zurückgehen, wo sie hergekommen waren. Was war denn mit seiner Identität? War er nicht ein guter Franzose geworden wie die anderen Elsässer, die Bretonen, die Katalanen und …? Na ja, die Korsen, dort gab es ein paar Verrückte, die sich ähnlich aufführten wie diese Araber. Aber dieser Staat war das Mutterland der Menschenrechte, Tausende hatten ihr Leben für diese Idee gelassen, hatten sie unter anderen Völkern verbreitet, und die Republik hatte immer wieder Tausende im Namen dieser Idee aufgenommen, ihnen eine Heimat gegeben. Aber natürlich war das nicht umsonst zu haben: Der Preis war die volle und bedingungslose Einordnung in diese Republik, die Anerkennung, ja, die Verehrung ihrer Werte und Prinzipien, und das war nur möglich, wenn man dieses ganze alte Gerümpel von Herkunft, Religion, Sprache und was es sonst noch sein mochte, vergaß und sich als Einzelner dieser einzigartigen Republik verschrieb. War dieser Preis etwa zu hoch?
Er versuchte, sich auf den vor ihm liegenden Bericht zu konzentrieren. Der V-Mann war ein Algerier wie die meisten der Bewohner dieser elenden Betonsilos. Er war speziell zur Beobachtung der islamistischen Szene angeworben worden; für die übrigen Spinner, die Autos anzündeten und mit Drogen handelten, gab es andere V-Leute. Was er berichtete, klang mysteriös und beunruhigend: Nach dem Freitagsgebet in der Moschee, die in einem früheren Lagerschuppen inmitten eines heruntergekommenen Gewerbegebiets am Rande der Wohnsilos untergebracht war, hatte er mit den Kameraden der Vereinigung Masjid Okba wie üblich zusammengesessen. Dann tauchten plötzlich, vom Vorsitzenden der Vereinigung geführt, zwei unbekannte Männer auf. Sie waren glatt rasiert, trugen moderne Anzüge und sahen europäisch aus. Der Vorsitzende stellte sie als bosnische Brüder vor, die gekommen seien, um den islamischen Kampf zu unterstützen. Nach dem Begrüßungsritual wurden Wachen vor dem Versammlungsraum aufgestellt, und es wurde Tee ausgeschenkt.
Der ältere der beiden, ein hagerer, blasser Typ, begann zu reden. Ja, sie seien aus Bosnien, dem islamischen Land, das dem Zentrum Europas am nächsten liege. Nach langer Unterdrückung durch die Ungläubigen hätte ihr Volk in einem heldenhaften Kampf dank der Gnade Allahs – dem Allmächtigen, dem Barmherzigen, dem Erbarmer – seine Unabhängigkeit errungen. Ohne die Hilfe verläßlicher Freunde wäre es freilich unmöglich gewesen, vom Dar al-Harb, vom Kriegsgebiet, zum Dar al-Islam, zum islamischen Gebiet, zu werden. Einige der eifrigsten Glaubenskämpfer unter ihren Verbündeten wollten sich nun, da ihre Mission in Bosnien beendet sei, dem Kampf in einem anderen Dar al-Harb zuwenden. Ihr Ziel sei es von alters her, die Ungläubigen und ihre Helfershelfer unter den islamischen Herrschern – verflucht sei ihr Name – zu bekämpfen. Um den verderblichen Einfluß der sittenlosen westlichen Mächte einzudämmen, müsse man sie nicht nur in den islamischen Gebieten schlagen, sondern auch im Herzen ihres eigenen Machtgebiets. Auch hätten diese Brüder noch alte, ja, uralte Rechnungen zu begleichen, und zwar in eben diesem Dar al-Harb, in dem sie jetzt säßen. Dafür bräuchten sie die Unterstützung ihrer hier lebenden Brüder, die – wie sie wüßten – in einem harten Kampf gegen die Regierung der Ungläubigen stünden, weil diese den Unterdrückern des wahren Glaubens in ihrem Heimatland Algerien helfe. Sie würden deshalb den gleichen Feind bekämpfen, im Osten wie im Westen des Dar al-Islam, und hier im Herzen des Feindeslandes träfen sich die beiden Kampflinien. Die Brüder vom Bai’at al Imam erwarteten ihre Antwort, die sie bald überbringen müßten.
An dieser Stelle brach der Bericht des Agenten ab. Zur Beratung über das weitere Vorgehen und die konkrete Hilfe für die fremden Brüder war nur noch der engere Führungszirkel der Vereinigung zugelassen. Die anderen mußten den Versammlungsraum verlassen und trieben sich in kleinen Gruppen noch eine Weile zwischen den öden Baracken herum, bis auch die letzten sich auf den Weg zu den Hochhäusern machten, deren hochgelegene Stockwerke wie Raumschiffe über der sternenlosen Nacht schwebten. Im Versammlungsraum brannte immer noch Licht, als der V-Mann mit der letzten Gruppe davon schlenderte.
Das Telefon läutete. Der Kommissar nahm den Hörer ab, bereit, ihn weit weg vom Ohr zu halten, falls es der Präfekt sein sollte. Und er war es tatsächlich.
»Bonjour, mon cher. Wie geht es Ihnen? … Sehr schön. Der Minister hat sich überraschend für Morgen angekündigt. Er will sich über die Ergebnisse des Plans Vigipirate in unserer Region informieren. Sie haben zwei Dinge zu tun: Erstens ist Ihre Gruppe für die Sicherheit des Ministers während seines Aufenthalts verantwortlich. Zweitens müssen Sie als Koordinator für die Bekämpfung des islamistischen Terrors in unserer Region eine Bilanz des Plans vorlegen, die selbstverständlich positiv ausfallen wird. Aber das kennen Sie ja… Ich erwarte Sie in einer Stunde in meinem Büro, wo wir zusammen mit den Verantwortlichen der anderen Sicherheitsbehörden den Besuch minutiös vorbereiten wollen.«
Der Plan Vigipirate war seit einigen Wochen in Kraft. Er war die Reaktion auf die Serie von Anschlägen islamistischer Terroristen, die mit einer Bombenexplosion in der Metrostation Saint-Michel in Paris begonnen hatte. Dabei hatten sieben Menschen ihr Leben verloren und 117 waren verletzt worden. Danach hatte es noch fünf weitere Anschläge gegeben, zuletzt auf eine jüdische Schule in Villeurbanne, einem Vorort von Lyon. Der Plan Vigipirate sollte weitere Attentate verhindern, war aber nach Meinung des Kommissars und seiner Kollegen nichts weiter als ein großangelegtes psychologisches Manöver der Regierung zur Beruhigung der aufgebrachten Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit bestand hauptsächlich in geifernden Bildberichten des Fernsehens und scharfen Kommentaren der Tagespresse. Für einen erfahrenen Polizisten war klar, daß man mit hektischem Aktivismus höchstens durch Zufall einen der gesuchten Terroristen fangen konnte. Aber es machte sich natürlich gut, wenn die Leute beim Betreten von Kaufhäusern oder Kinos ihre Handtaschen öffnen mußten oder der Kofferraum ihres Wagens durchsucht wurde, wenn sie auf einen Parkplatz fahren wollten. Die guten Bürger unterzogen sich bereitwillig diesen Prozeduren und bestätigten sich gegenseitig mit ernsthafter und wichtiger Miene, daß auch sie damit ihren Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus leisteten. Sie hatten ja ein gutes Gewissen, während diese verdammten Araber sich ohnehin kaum noch aus ihren verlotterten Vororten heraus trauten.
Wie aber sollten hinterher die vielen Überstunden seiner Beamten wieder abgebaut werden, fragte sich der Kommissar, während er die zweihundert Meter zur Präfektur weiter oben in der Avenue des Vosges ging. Das interessierte die Politiker natürlich nicht, sie wollten mit allen Mitteln die Öffentlichkeit beeindrucken.
Bei der Besprechung im Büro des Präfekten herrschte größere Aufregung als sonst. Schließlich kam der Innenminister nicht jeden Tag in die kleine Provinz, und schon gar nicht so unvorhergesehen. Und er war ja auch nicht irgendein Minister, nein, er war der Sohn eines großen Mannes, der dem General de Gaulle als Premierminister gedient hatte. Jetzt gehörte er selbst zu den Baronen der gaullistischen Bewegung, und mit der islamistischen Terrorwelle hatte er die erste große Bewährungsprobe in seinem neuen Amt zu bestehen. Der Plan Vigipirate hatte deshalb unter allen Umständen ein Erfolg zu sein, auch in ihrer bisher ruhig gebliebenen Region, das machte der Präfekt mit gerötetem Gesicht und hoher Stimme unmißverständlich klar.
Kommissar Graff hörte mit halbem Ohr hin, als der Präfekt wieder und wieder die Bedeutung des morgigen Tages und die schrecklichen Folgen eines – unter allen Umständen zu verhindernden! – Mißerfolges ausmalte. Er beobachtete seine Kollegen, die mit teils gespielter, teils mit echter Aufmerksamkeit um den ovalen Tisch herumsaßen. Einige machten sich noch Hoffnungen und blickten ehrgeizig in die Zukunft, während die anderen – meist die älteren – längst schon die Nichtigkeit solchen Strebens eingesehen hatten und nichts mehr haßten, als in der Routine täglicher Verwaltungsarbeit über Gebühr gestört zu werden. Nur in einem waren sie sich einig: im eifersüchtigen Wachen über die Kompetenzen des eigenen Dienstes, weswegen sie sich untereinander einen gnadenlosen Kleinkrieg lieferten.
Alle, die um diesen Tisch herumsaßen, repräsentierten das undurchdringliche Gestrüpp der französischen Polizeibehörden und Geheimdienste. Dieses war zunächst als kleine Pflanze unter dem Polizeiminister Fouché zu Zeiten Napoleons recht gut gediehen, hatte sich durch die Jahrhunderte gewuchert, ob Monarchie oder Republik, und war jetzt, am Ende des 20. Jahrhunderts, zur vollen Blüte ausgewachsen. Da saßen Dufour von der DCRG (Direction Centrale des Renseignements Généraux), Grignon von der DST (Direction de la Surveillance du Territoire), Delpont von der DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) und Esposito von der DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire). Und da war dann noch seine eigene Kommandogruppe der Nationalgendarmerie und der Kollege Ostermann, dem eine gleiche Gruppe der nationalen Polizei unterstand. Dieser, neben ihm der einzige Elsässer in der Runde, musterte ihn heute besonders feindselig, weil ihm als Vertreter der Polizei eigentlich die Bewachung seines Dienstherrn, des Innenministers, zugestanden hätte. Aus unerfindlichen Gründen, die mit hoher Politik zu tun haben mußten, sollte aber die Gendarmerie, die dem Verteidigungsminister unterstand, diese Aufgabe übernehmen.
Der Besuch des Ministers war ein voller Erfolg, wie man in den Zeitungen des folgenden Tages nachlesen konnte. Er hatte zunächst die Europabrücke an der Rheingrenze zwischen Straßburg und Kehl inspiziert. Dort legte ihm der Präfekt persönlich – umgeben von Vertretern der Grenzpolizei und des Zolls – eine Bilanz der vergangenen vier Wochen vor. Der kleine Mann mit dem roten Gesicht hatte Mühe, mit seiner hohen Stimme gegen den kräftigen Wind anzukommen, der durch das Rheintal fegte. Zwischen den vorüberjagenden Wolken blitzte immer wieder die kaum wärmende Spätherbstsonne hindurch und tauchte die auf dem Mittelstreifen der beiden Fahrbahnen stehende, um den Minister und den Präfekten gescharte Gruppe von Beamten, Sicherheitsleuten und Journalisten in ein mildes Licht.
»Seit Beginn des Monats«, quäkte der Präfekt, »wurden 1095 Ausländer an den Grenzen unserer Region zurückgewiesen, und 126 gesuchte Personen konnten festgenommen werden. Das sind viermal so viele wie in den zwei Monaten davor! Allein gestern haben die Grenzbehörden 17 Personen die Einreise verweigert, und fünf Gesuchte wurden verhaftet. Noch vor drei Stunden, Herr Minister«, und jetzt überschlug sich seine Stimme förmlich, »wurde an dieser Stelle, an der wir jetzt stehen, ein Verdächtiger festgenommen, von dem wir annehmen, daß er mit dem terroristischen Milieu in Verbindung steht.« Der Präfekt blickte triumphierend auf den Minister und versuchte gleichzeitig mit einem Auge mitzubekommen, ob auch die Presseleute ihn verstanden hatten.
Denn es war natürlich der eigentliche Zweck des Ministerbesuches, den Medien, und damit der Öffentlichkeit, Entschlossenheit und Wirksamkeit zu demonstrieren und den guten Bürgern das Gefühl zu geben, daß dieser Staat sie unter allen Umständen schützen würde, selbst gegen Dinge, gegen die es keinen Schutz gibt, wie zum Beispiel ihre eigene Dummheit, so hatte es der Präfekt auf der Vorbesprechung süffisant ausgedrückt. Diesem Ziel war alles andere untergeordnet worden, und um sein Gelingen sicherzustellen, waren die Telefonleitungen zwischen Ministerbüro und Präfektur gestern heiß gelaufen. Nachdem auch die letzten Details – die Fahrtroute, die genauen Zeiten der einzelnen Ereignisse, der Ort und das Arrangement des Büfetts, die Größe und Ausstattung der Konferenzsäle, die problemlose Erreichbarkeit von Garderoben und Toiletten, die Verfügbarkeit von Regenschirmen und tragbaren Mikrofonen – zwischen dem Leiter des Ministerbüros und dem Kanzleichef des Präfekten geklärt waren, setzte sich die ganze schwere Maschinerie in Bewegung, schreckte Behörden auf, ließ ausschwärmen, untersuchen, inspizieren, berichten und wurde vom Präfekten nach Abwägung aller erhaltenen Informationen und nach erneuter Beratung mit den Chefs der Sicherheitsdienste noch einmal mit noch genaueren Instruktionen versehen erneut in Gang gesetzt.
Knurrend hatte Kommissar Graff bei der zweiten Besprechung bemerkt, daß es ihm nicht nur an Geld und Leuten zur Terrorismusbekämpfung fehle, sondern ihm jetzt auch noch die Zeit dafür gestohlen würde. Das hatte ihm einen kurzen, scharfen Verweis des Präfekten eingebracht, der ihn daran erinnerte, daß es erste Beamtenpflicht sei, seine Vorgesetzten zufriedenzustellen, auch wenn er persönlich ebenfalls vieles als heiße Luft empfinde, was die Herren da in Paris manchmal so produzierten. »Doch jetzt haben wir uns mit dem Büfett zu beschäftigen, denn wie Sie vielleicht wissen, ist der Minister ein ausgesprochener Gourmet, und ich kenne mehrere Fälle, in denen Kollegen deswegen schwer Punkte eingebüßt haben. Sie werden verstehen, daß ich kein Interesse daran habe, daß mir auch so etwas passiert.« Mit einer Mischung aus Verachtung und Bewunderung über so viel zynisches Duckmäusertum lehnte sich Graff in seinen Sessel zurück und blieb den Rest der Sitzung über stumm.
Das Drehbuch, das der Präfekt für den Ministerbesuch entworfen hatte, sah eine psychologische und emotionale Steigerung von Ereignis zu Ereignis vor. Einem Fachbuch für public relations hatte er entnommen, daß dies den Effekt bestimmter Aktionen ungeheuer anheben könne, weil beim Betrachter damit eine innere Bereitschaft ausgelöst würde, den Hauptdarsteller – in diesem Fall den Minister – in einem positiven Licht zu sehen. Wichtig war es natürlich, in der Kürze der Zeit das richtige Publikum für die Auftritte des Ministers zu mobilisieren. Aber dafür hatte man ja seine erprobten Kanäle…
Und so waren am nächsten Morgen auf der Rheinbrücke neben der Entourage des Ministers auch die Medien einträchtig versammelt: die regionalen Fernseh- und Rundfunksender ebenso wie die beiden großen Regionalzeitungen, die Dernières Nouvelles d’ Alsace aus Straßburg und die Zeitung L’ Alsace aus Mulhouse. Wichtiger aber für den Minister war die Tatsache, daß auch die regionalen Korrespondenten der großen Pariser Blätter anwesend waren. Sogar die deutschen Medien von der anderen Seite des Rheins waren vertreten: der Südwestfunk aus Baden-Baden und die großen Regionalblätter Badische Zeitung aus Freiburg und Badische Neueste Nachrichten aus Karlsruhe. Doch die sah der Präfekt nicht so gerne, weil die Deutschen immer wegen angeblicher Verletzungen des Schengener Abkommens aufgrund der verstärkten Grenzkontrollen herummäkelten. Seine Pressestelle hatte die deutschen Medien routinemäßig eingeladen, wie sie es immer tat, wenn Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit berührt wurden. Der Präfekt ärgerte sich, daß er diesen Punkt übersehen hatte, auch wenn Berichte in deutschen Blättern natürlich nicht die gleiche Bedeutung hatten, als wenn sie in Frankreich erschienen. Aber er hatte nun einmal den Ehrgeiz, eine Sache perfekt über die Bühne zu bringen. Er mußte dem Minister unbedingt noch ins Ohr flüstern, diesen Punkt in seiner Ansprache ja nicht zu vergessen.
Der Minister bedankte sich für den Bericht des Präfekten: »Wir sehen daran deutlicher denn je, daß der Plan Vigipirate notwendig und sinnvoll war. Ich bin froh, daß wir diesen Plan rechtzeitig nach den ersten verbrecherischen Anschlägen in Kraft gesetzt und damit sicherlich Schlimmeres verhindert haben. Ich möchte die beteiligten Sicherheitsbehörden, und ich schließe den Zoll und das Militär mit ein, zu ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beglückwünschen. Diese hat wieder einmal deutlich gemacht, daß das verantwortungslose Gerede von einem angeblichen Kompetenzwirrwarr in den staatlichen Sicherheitseinrichtungen völlig fehl am Platze ist.« Er wandte sich mit einem leichten Lächeln in Richtung der deutschen Journalisten, die ihm der Präfekt kurz zuvor signalisiert hatte. »Wir stehen hier an einer historischen Stelle. Hier wurden erstmals die Grenzen zwischen zwei europäischen Staaten durchlässig gemacht. Ich möchte betonen, daß Frankreich das Abkommen von Schengen im Hinblick auf die Information und die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden strikt einhält. Wir nehmen zur Zeit lediglich die im Abkommen vorgesehene Ausnahmeregelung zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Anspruch, um in unserem Land eine normale Sicherheitslage wiederherzustellen, auf die unsere Bürger Anspruch haben.«
Genau nach Plan verließ die Wagenkolonne des Ministers die Europabrücke in Richtung Innenstadt. Im ersten Wagen hinter der schwarzen Ministerlimousine, in der auch der Präfekt mitfuhr, saß der Kommissar mit zwei seiner besten Leute. Gendarmen in schwarzer Lederkleidung umschwärmten die Kolonne auf schweren Motorrädern wie ein Schwarm aufgeschreckter Hornissen. Sie fuhren durch die wenig einladende Umgebung der Industrievororte, die den nahen Hafen ankündigten. An der Stelle, wo sie nach Norden abbogen, um die Altstadt auf dem Weg zur Präfektur zu umfahren, überquerten sie die Rue du Landsberg, die direkt in die Vorstadt Neuhof führte. Aber davon wußte der Minister sicherlich nichts, und der Präfekt würde sich hüten, ihn darauf aufmerksam zu machen. Graff aber wurde schmerzlich daran erinnert, daß dort eine Gefahr lauerte, die er noch nicht einzuordnen wußte. Im Augenblick hatte er jedoch andere Sorgen…
Der große Saal der Präfektur glänzte in seinem besten Licht. Das große Podium an der Stirnseite war mit üppigen Blumenbuketts geschmückt. Trotz der Tageszeit waren die schweren Kristallüster hell erleuchtet. Niemand sollte übersehen, daß die zweite Szene aus dem Drehbuch des Präfekten ihren Anfang nahm.
Dieser hatte zusammen mit dem Minister auf dem Podium Platz genommen. In den beiden Ecken hinter dem Podium standen zwei Leibwächter in kugelsicheren Westen, die mit kühler Miene und verschränkten Armen den Saal beobachteten. Der war fast vollständig gefüllt mit den Verantwortlichen der verschiedenen Sicherheitsbehörden, Honoratioren der Stadt, Leitern von staatlichen Ämtern, Journalisten, Diplomaten, Parlamentariern und Repräsentanten der gesellschaftlichen Gruppen. Einen besonderen Ehrenplatz nahmen die Vertreter der religiösen Gemeinschaften ein, die in unmittelbarer Nähe des Podiums plaziert waren. Da saßen mit heiterer und gewichtiger Miene der katholische Erzbischof und der Bischof der protestantischen Minderheit, die immerhin 25 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachte. Und da saßen mit ernsten Gesichtern der Imam der Straßburger Moschee, Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft des Elsaß, und der Großrabbiner des Départements Bas-Rhin als Repräsentant der Jüdischen Gemeinde, die allein in der Stadt Straßburg 15.000 Mitglieder zählte.
Dem Präfekten stand der Schweiß auf der Stirn, wie Graff gut beobachten konnte, denn er saß in einer der ersten Stuhlreihen. Und er konnte sich auch denken, was dem kleinen Mann Unbehagen bereitete: Es war das unübersehbare Trommeln der Fingerspitzen, mit dem der Minister seiner wachsenden Ungeduld Ausdruck verlieh. Die beiden Herren, und mit ihnen die übrige im Saal versammelte Männergesellschaft, der nur zwei Journalistinnen einen bunten Tupfer verliehen, warteten auf die Oberbürgermeisterin, die jetzt – mit fünfzehnminütiger Verspätung – gelassen, ja fast provozierend langsam den großen Saal bis zum Podium durchschritt. Alle Augen waren auf die hochgewachsene blonde Frau gerichtet, die – attraktiv und populär – dem linken Lager angehörte und mit ihrem wohl kalkulierten Auftritt ihre Unabhängigkeit als gewählte Vertreterin des Stadtvolkes demonstrierte. Dabei hatte der Präfekt sich diesen Auftritt als besondere Geste ausgedacht, mit der vor aller Öffentlichkeit die Einheit der Nation über alle Parteigrenzen hinweg in einer so wichtigen Frage deutlich gemacht werden sollte. Dafür hatte er sogar in Kauf genommen, daß neben dem Kommissar-Oberst Graff auch ein Vertreter der Stadtverwaltung seine Ansichten über die Bekämpfung der islamistischen Gefahr durch eine Politik der offenen Arme ausbreiten durfte. Das süß-saure Lächeln, mit dem er eilfertig der Oberbürgermeisterin zur Begrüßung entgegen stürzte, bestätigte Graff in seiner Gewißheit, daß der Präfekt in diesem Augenblick seine Idee zutiefst bereute, denn ebenso gewiß war, daß er soeben beim Minister mindestens einen Punkt eingebüßt hatte.
Nach den gewichtigen, dem Ernst der Lage angemessenen Grußworten der drei Persönlichkeiten des Podiums, wobei sich auch die linke Oberbürgermeisterin keinesfalls im Ton vergriff, wie man im Saal teils befriedigt, teils enttäuscht zur Kenntnis nehmen konnte, führte der Präfekt den ersten Redner ein, den Kommissar-Oberst Jean-Jacques Graff, Chef der Kommandogruppe der Nationalgendarmerie und Koordinator zur Bekämpfung des islamistischen Terrors in der Region. Der Kommissar-Oberst sei in seiner doppelten Eigenschaft als Polizist und Militär in besonderer Weise geeignet, diese verantwortungsvolle Aufgabe zum Schutze von Republik und Nation in dieser ernsten Stunde wahrzunehmen, führte der Präfekt aus. Sein Bericht würde jedem der Anwesenden vor Augen führen, wie gefährlich die Lage sei und welche Maßnahmen die Behörden schon getroffen hätten, um dieser Gefahr mit rechtsstaatlichen Mitteln, aber auch mit aller Härte des Gesetzes entgegenzutreten.
Graff ging mit gemessenen Schritten zum Rednerpult. Er wußte, was von ihm erwartet wurde, und ihm war klar, daß einiges für ihn davon abhing, welchen Eindruck er beim Minister hinterlassen würde. Gewiß, der Innenminister war nicht sein Dienstherr, aber ein so mächtiger Herr konnte durchaus seinen Einfluß geltend machen, wenn es etwa um die Versetzung eines hohen Beamten in der Domäne eines Ministerkollegen ging.
»Madame le Maire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, Eminences, Excellences, Mesdames et Messieurs – wie der Herr Präfekt schon sagte, bin ich Militär und Polizist in einer Person. Mein Bericht wird deshalb militärisch knapp und polizeilich luzide sein. Ich werde mich nicht mit den soziologischen und politischen Aspekten des islamistischen Terrorismus befassen, denn mir wurde gesagt, daß dies der nachfolgende Redner tun wird. Ich werde mich ausschließlich den Folgen dieser Bewegung für die nationale Sicherheit widmen und den Maßnahmen, die wir zu ihrer Bekämpfung ergriffen haben.
Zunächst möchte ich ein Wort zur geographischen Lage unserer Region sagen, weil wir als Grenzland eine besondere Rolle sowohl in den Überlegungen der Terroristen als auch in unseren Abwehrmaßnahmen spielen. Wenn Sie auf das Dach der Präfektur steigen würden – was ich Ihnen jetzt nicht zumuten möchte – , dann könnten Sie von dort den Schwarzwald sehen. Der liegt, wie Sie alle wissen, in Deutschland. Mit der Öffnung der Grenzen zwischen unseren beiden Ländern – nicht erst seit dem Schengener Abkommen – ist diese Region zwischen Karlsruhe und Freiburg zu einer logistischen Basis, zu einem Ruheraum für islamistische Extremisten geworden. Wir verfügen über genügend Belege dafür, über Hotelrechnungen und Tankquittungen.«
Er sah von seinem Manuskript auf und suchte im Publikum die deutschen Journalisten, deren Gesichter er sich auf der Europabrücke einzuprägen versucht hatte.
»Diese Beweise verdanken wir den deutschen Behörden, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Von ihnen wissen wir auch, daß als Anlaufstellen für neu ankommende Terroristen sogenannte Muslimbruderschaften dienen. Solche Organisationen sind in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim tätig. In Freiburg bietet eine Moschee den Raum für den ersten Kontakt. Engere Verbindungen werden danach in privaten Treff- und Gebetsräumen geknüpft.
Diese Stützpunkte auf der deutschen Seite dienen der Sammlung von Geld unter den in Deutschland ansässigen Muslimen, der Vorbereitung von Aktionen, der Rekrutierung von Aktivisten und dem Transport von Waffen sowohl nach Frankreich als auch nach Algerien. Deutsche wie französische Ermittler sind umfangreichen Waffen- und Sprengstoffexporten auf der Spur. Das Material stammt fast ausschließlich aus dem Osten; vor allem aus Tschechien und der Slowakei wird es nach Deutschland gebracht, dort zwischengelagert und in kleinen, unauffälligen Schüben nach Frankreich weiterbefördert, wo es entweder für Anschläge – wie in den letzten Wochen – verwendet oder weiter nach Algerien transportiert wird.
Dabei spielt unsere grenznahe Region eine wichtige Rolle. Denn von Deutschland aus finden Material und Personen ihren Weg über die bis vor kurzem fast nicht mehr kontrollierten Grenzübergänge bei Neuenburg, Breisach und Sasbach. Deshalb ist unsere Region zu einer wichtigen islamistischen Operationsbasis geworden, die zwei Hauptstützpunkte hat: die Stadt Mülhausen im Süden des Elsaß und die südlichen Vororte von Straßburg. Warum das so ist, hängt mit den demographischen Bedingungen an diesen beiden Orten zusammen, die mein Nachredner Ihnen wahrscheinlich erläutern wird. Ich möchte hier nur noch darauf hinweisen, daß auch die Schweiz – als drittes Element in diesem Länderdreieck – von den Aktivitäten der Terroristen betroffen ist: Die jüngsten Drohbriefe gegen westliche Botschaften in Algier sind auf einem Basler Postamt aufgegeben worden, nur einen Katzensprung von Mülhausen entfernt. Wir können deshalb mit Fug und Recht die Region am Oberrhein als Relais für den islamistischen Terrorismus bezeichnen. Glücklicherweise bedeutet dies auch, daß in der Region selbst noch keine Anschläge stattgefunden haben, weil die Terroristen ihre Basis nicht gefährden wollen.«
Graff blickte von seinem Manuskript hoch. Er war kein guter Redner, weswegen er sich immer krampfhaft an einen sorgfältig formulierten, mit großem Zeilenabstand geschriebenen Text hielt. Auf seinem massigen Schädel, der von einem schütteren Haarkranz gekrönt wurde, perlten die Schweißtropfen. Warum bloß hatte er vergessen, sich ein Taschentuch einzustecken, wo er doch wußte, daß er beim Reden vor großem Publikum immer ins Schwitzen geriet? Auf dem Podium zumindest hatten sie wohlwollende Mienen aufgesetzt. Die Gesichter im Publikum konnte er nicht deutlich erkennen, so sehr blendeten ihn die Kristalleuchter und die Halogenlampen der Fernsehleute.
»Kommen wir jetzt zu den nationalen, ja, internationalen Auswirkungen dieser Vorgänge, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Von unseren Kollegen in Deutschland und in der Schweiz wissen wir, daß – genau wie bei uns – Nordafrikaner, Türken und Iraner zunehmend zusammenrücken. Das heißt, unsere Dreiländerregion ist zu einer Drehscheibe für muslimische Aktivitäten in ganz Westeuropa geworden. Das bestätigen auch unsere Erkenntnisse über Schlepperorganisationen, die illegale Einwanderer nach Europa bringen.
Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Minister, möchte ich gerne aus den Protokollen des Untersuchungsausschusses der französischen Nationalversammlung zur illegalen Einwanderung vortragen. Dort heißt es, ich zitiere: Im Laufe der beiden letzten Jahre konnten wir feststellen, daß die Schleppernetze sehr gut organisiert sind und völlig professionell arbeiten. Bei ihrem Vorgehen nutzen sie jede Lücke im Gesetz. Seit Jahresanfang stellen wir einen verstärkten Druck an der französisch-italienischen Grenze fest, über die Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, Türken, Rumänen und Algerier kommen. Die Schweizer Grenze steht an zweiter Stelle. Dort sind es vor allem Türken, Marokkaner, Rumänen, Brasilianer. An dritter Stelle kommt die französisch-deutsche Grenze mit Türken und Rumänen. Zur Zeit bemerken wir, daß die Algerier, die früher über Italien direkt nach Frankreich kamen, jetzt den Weg über Polen oder Tschechien und Deutschland nehmen. Desgleichen scheuen Leute aus Schwarzafrika nicht den Umweg über Warschau oder Budapest, um dann durch Deutschland und Belgien nach Frankreich zu gelangen. Jede Gruppe hat ihre eigene Organisation, so zum Beispiel die Türken. Drei-, vieroder fünftausend Türken, darunter viele Kurden, warten ständig an der albanischen Küste auf die Überfahrt nach Süditalien. Von Bari oder Lecca gelangen sie in Etappen an die französisch-italienische Grenze. Jede Etappe muß gesondert bezahlt werden. So werden sie von Schlepper zu Schlepper geschleust, bis in die Gegend von Mentone, wo sie meist von einem Lastwagenfahrer übernommen werden, der sie nach Cannes bringt. Von dort geht es nach Deutschland weiter. Der Weg von Bari bis Deutschland kostet pro Person 20.000 bis 30.000 Francs. Auch die Marokkaner, die früher über Spanien kamen, ziehen jetzt den Weg über Italien vor. Zwei kleine Inseln, die Sizilien vorgelagert sind, dienen als Anlaufstellen für Einwanderer aus Algerien, Tunesien, Marokko oder Schwarzafrika. – Ende des Zitats.
Meine Damen und Herren, ich habe diesen Bericht deswegen so ausführlich zitiert, weil er klar macht, mit welchen Problemen wir es zu tun haben. Erstens wird daraus deutlich, daß unsere Region am Schnittpunkt dieser Einwandererströme liegt – von Osteuropa über Deutschland nach Frankreich, und von Italien über Frankreich nach Deutschland. Und zweitens ist offensichtlich, daß diese illegalen Einwanderer ein ideales Rekrutierungspotential für Extremisten aller Art bieten. Die Drahtzieher und der harte Kern der Aktivisten verfügen selbstverständlich über eigene Netze und Tarnorganisationen, mit deren Hilfe sie sich in ganz Europa bewegen können.«
Graff war jetzt völlig durchgeschwitzt. Die vielen Menschen und Lichter machten den großen Raum unerträglich heiß. Er war froh, daß er sich dem Ende seines Manuskripts näherte.
»Damit komme ich zum letzten Punkt. Er betrifft die internationalen Netze der Terroristen und ihre Bedeutung für die nationale Sicherheit, gerade auch in unserer Region. Wir wissen, daß im November 1992 in der albanischen Hauptstadt Tirana ein Islamisten-Treffen stattgefunden hat. Vertreten waren dort nach unseren Erkenntnissen alle bedeutenden Organisationen, die in Europa operieren: die Islamische Heilsfront (FIS) und die Bewaffnete Islamische Gruppe (GIA) aus Algerien; die Hamas und der Islamische Dschihad aus Palästina; die libanesische Hisbollah und die Islamische Front Tunesiens. Dazu kamen islamistische Gruppen aus Ägypten, der Türkei, Bosnien und Albanien. Und schließlich waren auch die fundamentalistischen Regime in Iran und Sudan vertreten.
Bei diesem Treffen wurde die Karte Europas in Einsatzgebiete aufgeteilt und die verschiedenen Untergrundnetze miteinander verknüpft. Dies funktioniert deswegen gut, weil die vielleicht 150 bis 200 führenden Köpfe der verschiedenen Netze eines gemeinsam haben: Fast alle haben zuerst in Afghanistan und danach in Bosnien gekämpft. Daher sind sie eng miteinander vertraut und das erklärt auch, daß die Nationalitätsunterschiede keine Rolle spielen, weil sie alle für das gleiche Ziel kämpfen. Dieses hat das Sprachrohr der Extremisten in Europa, die Wochenzeitung Al Ansar, so formuliert: Beseitigung der gottlosen Regime im Nahen Osten durch die Errichtung von Gottesstaaten und Bekämpfung des teuflischen Okzidents, Heimat der alten und neuen Kreuzfahrer. Die Koordinierung erfolgt durch eine Tarnorganisation namens Human Concern International, die 1985 als Hilfskomitee für Afghanistan-Kämpfer gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz in Stockholm, mit Zweigstellen in London, Warschau, Tirana und Khartum. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, daß sich in der letzten Zeit Anzeichen für ganz merkwürdige Konstellationen häufen: Unsere deutschen Kollegen berichten, daß einerseits die linksextremen Antiimperialistischen Zellen für die Zusammenarbeit mit islamischen Fundamentalisten werben und andererseits neonazistische Gruppen sich mit diesen solidarisieren. Einfacher zu erklären sind gewisse Querverbindungen zur vor allem in Deutschland aktiven Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Diese hat wie die Hisbollah ihr Hauptquartier im libanesischen Bekaa-Tal und wird wie diese von Syrien protegiert.«
Graff nahm einen Schluck Wasser und sah erneut von seinem Papier auf. Die letzten Sätze sprach er frei, den Blick fest in den Saal gerichtet.
»Ich denke, jedem in diesem Raum ist klar geworden, wie groß die Gefahr ist und wie notwendig die Maßnahmen waren, die der Herr Minister in den letzten Wochen in Gang gesetzt hat. Es hat seit drei Wochen keine Anschläge mehr gegeben, weil sich die Terroristen in ihre Schlupfwinkel zurückgezogen haben. Jetzt geht es darum, ihre logistische Basis und ihre Verbindungswege – gerade auch in unserer Region – zu zerstören, um ihnen somit die Möglichkeit für weitere Terroraktivitäten zu nehmen. Sie werden verstehen, daß ich aus Sicherheitsgründen dazu keine näheren Angaben machen kann. Ich danke Ihnen.«
Als erster fing der Minister an, Beifall zu klatschen, eilfertig folgten ihm der Präfekt und dann der ganze Saal. Die Oberbürgermeisterin hielt sich allerdings merklich zurück, sie rührte die Hände nur wenige Male. Jetzt ergriff sie das Mikrofon, um den zweiten Redner vorzustellen, Herrn Edouard Amini, Professor für Islamistik an der Universität für Humanwissenschaften in Straßburg, Berater des Europarats für multikulturelle Fragen und Beauftragter der Stadtverwaltung für Probleme der Integration.
Graff betrachtete jetzt erst, nachdem die Last der Rede von ihm gefallen war, den Mann genauer, der nur wenige Stühle von ihm entfernt gesessen und seinen Vortrag mit großer Aufmerksamkeit verfolgt hatte. Er war von kleiner, fast zierlicher Statur, trug die leicht gewellten Haare nach hinten gekämmt und sah überhaupt nicht aus wie ein Orientale. Er könnte Südfranzose oder Sizilianer sein, überlegte Graff und fragte sich, aus welchem nahöstlichen Land der Herr Professor wohl stammte. Als Amini jetzt an ihm vorbei zum Rednerpult ging, fielen ihm zum ersten Mal dessen gütige braune Augen auf, die ihn so schnell nicht wieder loslassen sollten.
Im Saal war inzwischen beträchtlicher Lärm entstanden. Das Publikum war unruhig, man wußte, daß nebenan ein Büfett wartete, und die Mittagszeit war schon angebrochen. Der Präfekt hatte alle Mühe, dem Redner Gehör zu verschaffen und bat ihn denn auch, sich möglichst kurz zu fassen.
Mit höflichem Lächeln versprach dies der zierliche Mann, wies aber daraufhin, er verstehe zwar, daß Fragen der nationalen Sicherheit und der Terrorbekämpfung oberste Priorität genössen, doch käme dabei eben immer die Analyse der Ursachen zu kurz, die zu diesen Problemen führten. Alle polizeilichen und militärischen Maßnahmen seien letzten Endes unzulänglich, vielleicht sogar vergebens, wenn man nicht die Gründe kenne und bekämpfe, die junge Menschen in den Extremismus und Terrorismus trieben. Ein Punkt sei, wie jedermann wüßte, die westliche Unterstützung für manche diktatorischen Regime im Nahen Osten. Wenn man dies aus übergeordneten politischen Gründen nicht ändern wolle oder könne, so sollte man doch zumindest im eigenen Land etwas tun. Die Gesellschaft müsse sich fragen, warum immer mehr junge beurs, in Frankreich geborene Nachkommen algerischer Einwanderer mit französischer Staatsangehörigkeit, in extremistische Aktivitäten verwickelt seien, weil sie ihre Identität wieder in Algerien suchten. Das könne doch nur damit zu tun haben, daß sie sich in Frankreich nicht akzeptiert fühlten, und man wisse ja, daß enttäuschte Liebe leicht in Haß umschlagen könne. Gefährlich sei es deshalb, aufgrund der schrecklichen Vorkommnisse der letzten Wochen alle Muslime als potentielle Extremisten anzusehen, weil man sie damit weiter in die Isolierung dränge und dadurch genau das heraufbeschwöre, was man eigentlich verhindern wolle: eine Radikalisierung zumindest mancher Gruppen, vor allem bei der Jugend. Bei seinem Vorredner habe er deshalb wenigstens einen Hinweis darauf erwartet, daß die erwähnten islamistischen Gruppen nur eine kleine Minderheit der in Europa lebenden Muslime repräsentierten.
Graff hob bei diesen Worten den Kopf und begegnete wieder diesen gütigen und zugleich forschenden Augen. Er mußte widerwillig zugeben, daß Amini ein ungleich besserer Redner war als er selbst und daß er vor allem ein makelloses Französisch sprach, das ihm seinen eigenen, schweren Akzent umso schmerzhafter bewußt machte. Auch im Saal war jetzt völlige Ruhe eingekehrt, alle hörten zu, als der Professor mit seiner leisen, aber eindringlichen Stimme Belege für seine Thesen anführte.
So neigten nach Erkenntnissen des deutschen Verfassungsschutzes höchstens ein Prozent der 2,2 Millionen in Deutschland lebenden Muslime radikalen Strömungen zu. In Frankreich lebten etwa 3,5 Millionen Muslime, davon 1,5 Millionen mit französischer Staatsangehörigkeit. Nach neuesten Umfragen des Nationalinstituts für demografische Studien mache ihre Integration gute Fortschritte. So lebte die Hälfte der jungen beurs mit einer französischen Partnerin, bei den Mädchen sei es immerhin ein Viertel. 70 Prozent der Jungen und 60 Prozent der Mädchen erklärten, sie seien »nicht gläubig«, was dem nationalen Durchschnitt entspräche. Allerdings gebe es einige Dinge, die diese positive Entwicklung gefährdeten: zunächst eine Identitätskrise, die mit dem minderen sozialen und kulturellen Status der Elterngeneration zusammenhänge und durch die diskriminierende Haltung eines Teils der Gesellschaft verstärkt werde. Dann eine soziale Krise, da über 50 Prozent der muslimischen Jugendlichen arbeitslos seien, doppelt so viele wie im Durchschnitt.
Mit einem Blick auf die Uhr verwies Amini bedauernd auf seine Schriften, in denen er praktische Vorschläge ausgearbeitet habe, um diesen Problemen zu begegnen. Er wolle aber noch ein Wort zur Region Elsaß sagen, diesem Relais des islamistischen Terrorismus, wie es sein Vorredner ausgedrückt habe. Das Elsaß sei eine der französischen Regionen mit dem höchsten Ausländeranteil, nämlich fast neun Prozent gegenüber etwa 6,5 Prozent im nationalen Durchschnitt. Es sei aber auch die Region mit dem höchsten Anteil rechtsradikaler Wähler, nämlich 25 Prozent bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Er überlasse es seinen Zuhörern, zu urteilen, was auf lange Sicht gefährlicher für die Nation sei. Allerdings sei er der Meinung, daß in den Brennpunkten der Stadt Mülhausen und in den südlichen Vororten von Straßburg dringend etwas getan werden müsse, doch sei dies zuallererst eine politische und weniger eine polizeiliche Aufgabe.
Der Beifall war höflich, am lebhaftesten noch bei den Journalisten und natürlich bei der Oberbürgermeisterin, wie Graff feststellen konnte. Er war sich sicher, daß dem Minister und dem Präfekten vor allem die letzten Worte des schmächtigen Professors nicht sonderlich gefallen hatten.
Nach dem Büfett, das für den Präfekten ein voller Erfolg war, begann der letzte Teil des Ministerbesuchs in der kleinen Provinz. Die Wagenkolonne verließ die Stadt in Richtung Westen, zunächst auf der autobahnartigen Ausfallstraße, die zur Zaberner Steige führte, der uralten Grenzscheide zwischen dem germanischen und dem romanischen Europa, die für die meisten Mitfahrenden noch immer das Elsaß vom inneren Frankreich trennte. Kurz vor den Bergen bog die Kolonne auf eine kleine Landstraße ein, die der untergehenden Sonne entgegen zu dem Dorf Kleinhoffen führte, das am Fuß einer hügeligen Waldlandschaft lag, die weiter nach Westen zu in die nördlichen Ausläufer der Vogesen überging. Ohne sich aufzuhalten, durchquerten die schwarzen Limousinen den unansehnlichen Ort, ständig umschwärmt von den schweren Motorrädern und einfältig bestaunt von den wenigen Dörflern, die sich auf der Straße aufhielten, um am nordwestlichen Ausgang in einen Waldweg einzubiegen, der geradewegs zum alten jüdischen Friedhof führte. Wie alle anderen israelitischen Begräbnisstätten des Elsaß lag auch diese weit abgelegen vom Dorf in einem Waldstück, auf daß sie kein Christenauge beleidigen könne. Den großen jüdischen Landgemeinden war es jahrhundertelang nicht erlaubt gewesen, ihre Toten in der Nähe der gläubigen Christen zu bestatten. Auch durfte nicht jede jüdische Gemeinde einen eigenen Friedhof haben, was dazu führte, daß Begräbnisse zu einer wahren Tortur wurden, kilometerlange Märsche bei jeder Witterung auf zerfallenden Straßen und begleitet vom aggressiven Spott der Dörfler, die ihr eigenes Elend den noch Rechtloseren heimzuzahlen suchten.
Daran mochte der Minister denken, als er jetzt zusammen mit seinen beiden halbwüchsigen Söhnen, die beim Büfett zu der Gruppe gestoßen waren, am Grab seiner Vorfahren stand. Graff, der sich schon von Amts wegen in seiner Nähe aufhalten mußte, war noch immer nicht aus dem Erstaunen herausgekommen, das ihn bei der Besprechung in der Präfektur ergriffen hatte, als das Drehbuch des Ministerbesuchs auch in diesem Punkt erörtert wurde. Niemals hätte er gedacht, daß dieser hohe Herr, ein leitender Kopf der nationalen Bewegung und Regierungspartei, daß ein so vollkommener Franzose und Patriot jüdischer Abstammung sein könnte. Gewiß, die Republik kannte keine Unterschiede in religiösen und rassischen Dingen, aber dennoch, das war erstaunlich.
Die Wagenkolonne setzte sich wieder in Marsch, hielt diesmal aber mitten im Dorf vor dem Rathaus an. Dort hatten sich neben dem Bürgermeister und dem vollständig versammelten Gemeinderat auch der Unterpräfekt des Bezirks und die lokalen Abgeordneten zur Begrüßung des Ministers eingefunden. Vor ihnen und seiner Entourage erklärte der Minister im schlichten Sitzungssaal des Rathauses, daß er mit dieser Rückkehr in den Schoß der Familie seine Hochachtung vor der Tradition durch die Ehrung der Erde und der Toten bekunden und daraus Kraft schöpfen wolle, um für eine Zukunft in Freiheit einzutreten. »Und genau darum geht es, wenn ich gegen Kriminalität, Terrorismus und illegale Einwanderung kämpfe.«
* * *
Bücher – Hier wohne ich
Inhalt
Die Balladen aus dem Nachlass des Göttinger Philosophen und Schriftstellers Gottfried Bürger wurden in den Jahren 1972 bis 1993 geschrieben. Bürger hat diese Gedichte in freien Rhythmen selbst nicht veröffentlicht.
Soll man Texte, die ein Autor ganz offensichtlich nicht veröffentlicht sehen wollte, am Ende doch öffentlich machen? Ist das erlaubt? Was ist dann von solchen Texten zu halten? Der Göttinger Philosoph und Schriftsteller Gottfried Bürger hat diese Balladen – wir wissen das aus seinen Tagebüchern – nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Kollegen und Freunde des im Jahre 1994 ermordeten Autors haben lange diskutiert, ob man gegen Bürgers Willen diese Texte herausbringen soll. Es sprach vieles dagegen, und vieles, am Ende mehr, sprach dafür, diese über einen langen Zeitraum und in unregelmäßigen Abständen geschriebenen Gedichte zugänglich zu machen.
Diese Veröffentlichung folgt einem Satz, den eine der Gestalten in Bürgers Erzählung ›Gwendolins Rache‹ sagt: »Nur wenn wir sie als Spiel betrachten, bekommt die Geschichte einen Sinn.«
Die sieben Illustrationen in diesem Band stammen von der japanischen Künstlerin Jikan.
Auszug
Erinnerungen
Ein Steilhang eines schroffen Gebirges und
weithin sichtbar aufgestellt
eine Fahne im Wind.
Ein gelber Fetzen,
der weithin kündet:
»Hier wohne ich, zum Ende
ausgebleicht.
Hier oben,
allein.«
Wer wollte die Beschwernisse des weiten Ganges,
des Steigens und Niedergehens und Steigens,
auf sich nehmen
nur für ein Windzeichen?
Weiß einer, ob sie noch lebt in ihrer armseligen Höhle,
diese Frau, die jetzt schon
so alt ist und
nur noch durch den Blick ihrer Augen
an die vergangene Schönheit erinnert?
Gesetzt, dass sie noch lebt.
So sahen wir also die Fahne
und blieben
in unseren sicheren Tälern.
Wir sahen hinauf.
»Hier wohne ich,
der Liebe
ausgebleichter Rest.«
De Mortuis
Während Rudolfo des Nachmittags in der Schlacht stand
und für die Ehre seines Vaterlandes focht,
stand Emanuel, sein Bruder, in der väterlichen Scheune
und beschloss die Resignation.
Rudolfo wurde getroffen
um Viertel vor vier
knapp oberhalb des linken Auges.
Emanuel brauchte länger, denn
er hatte Vorbereitungen zu treffen:
Ein Stuhl, ein Balken, ein Seil.
Rudolfo war mithin schon tot, als Emanuel
den Strick am Balken befestigt hatte und
sorgfältig die Knotenschlinge knüpfte.
Er sprang, als die Schlacht schon entschieden war.
Rudolfo siegte mit den Seinen.
Es lag nicht in Emanuels Verantwortung,
dass der Strick riss.
Sein Entschluss war fest und ehrlich gewesen.
Rudolfo verlieh man das Ehrenzeichen,
brachte ihn zum heimatlichen Friedhof, um ihn
mit militärischen Ehren
zu bestatten, den Orden auf dem Sarg.
Emanuel nahm,
ehe sie den Sarg des Bruders in die Erde senkten,
den Orden heimlich an sich.
Sonntag für Sonntag
steckt er ihn nun an und geht
über die Wiesen hinter dem väterlichen Gehöft.
Jeden, der ihm begegnet, fragt er:
»Habe ich diesen Orden nicht verdient?«
Alle ohne Ausnahme stimmen ihm zu
und gehen schnellen Schritts vorüber.
Die Schrift
»Verzeiht mir, Freunde,
dass ich euch belästige.
Ich weiß, es ist spät,
und die Läden eurer Fenster
sind schon geschlossen …«
So trat er, triefend vor Nässe,
vor seine Jünger.
Er schlug sich den Hut
mit einer verlegenen Geste auf
den rechten Oberschenkel
und sah zu Boden.
»Das Wetter ist schrecklich«, sagte er,
und die Jünger fanden,
ein solcher Satz sei eines Gottes unwürdig.
»Lieber hättest du, unser Gott,
dem Sturm ein Ende gebieten sollen,
statt dich in dieser Weise vor uns zu beklagen«,
sagte der Oberste Priester,
sein irdischer Stellvertreter,
und lachte verlegen.
»Sollen wir der Gemeinde verkünden,
du seist zu Fuß durch den Regen gekommen,
und der Schlamm an deinen Schuhen sei heilig?«
»Ich sehe, ihr wollt euch
darüber beraten, was zu tun sei«, sagte er.
»Ich werde solange vor die Tür gehen.
Holt mich herein, wenn ihr
zu einem Ende gekommen seid.«
Er wandte sich um und schloss leise die Tür.
»Was also sollen wir tun?«, fragte der Oberste Priester.
»Er ist unser Gott und wir müssen ihn aufnehmen«,
sagte ein anderer mit bedächtiger Miene.
»Und es kann sein, dass er
seine einstige Macht noch nicht ganz verloren hat«,
argwöhnte ein Dritter.
Sie kamen überein, dem Gott
vorübergehend Aufenthalt zu gewähren,
wenn er sie über die Auslegung
der schwierigen Stellen in den Heiligen Schriften belehre.
Jener Stellen, die sich ihrem steten Bemühen
bis zu diesem Tag widersetzt hatten.
So blieb der Gott und erklärte den Priestern
den Sinn der dunkelsten Sätze.
Als er damit geendet hatte,
sagten die Priester: »War uns die Bedeutung dieser Worte
jemals unklar? Nein, wir waren nur barmherzig,
und wir haben ihm Gelegenheit gegeben,
seinen Aufenthalt bei uns zu rechtfertigen.
Nun aber soll er wieder gehen, denn er ist ein Gott,
und in seiner Gegenwart fällt uns das Atmen schwer.«
An diesem Tag ging der Gott wieder fort,
und die Priester sahen ihm nach, als er
die glühende Straße entlang schritt.
Die Sonne brannte vom Himmel,
und jeder Schritt des Gottes wirbelte
den Staub der Straße empor.
Der Schöpfer
»Soll man der Form«,
fragte er den Schöpfer,
»Anteil an dem geben,
was erschaffen werden soll?«
Der Schöpfer antwortete:
»Die Form wird sein:
das ganz und gar Gewöhnliche.«
»Wie aber«, so fragte er verwirrt,
»kann das ganz Gewöhnliche
das neu Geschaffene bergen,
in dieser Stadt, die doch
auf ewig war und ist und sein wird?«
»Die Antwort auf diese Frage«,
sagte der Schöpfer,
ȟberlassen wir denen, die
die Stadt am Ende der Zeiten
bewohnen werden.«
Und versonnen setzte der Schöpfer hinzu:
»Denn du bist mein Sohn …«